Mann auf Mission
Der Unternehmer Julien Jacquet züchtet in einem Keller auf Kaffeesatz Speisepilze – und will damit auf Dauer die Landwirtschaft radikal verändern. Ein Laborbesuch.

// Der vereinbarte Treffpunkt klingt nach einer Touristenzentrale. Doch das von Brüssels Bewohnern „Tour & Taxis“ genannte Gebäude ist ein ehemaliges Warenlager, Teile des gleichnamigen Areals, auf dem es steht, gehörten einst der Adelsfamilie von Thurn und Taxis, daher die Bezeichnung. Mitten durch den gewaltigen Komplex verliefen früher Eisenbahnschienen, von denen einige noch erhalten sind. Heute beherbergt er Designerläden, Künstlerateliers, Co-Working-Räume und Cafés.
Nichts deutet darauf hin, dass in diesem hippen Industriecharme-Ambiente Landwirtschaft betrieben wird, fast nichts. Denn gleich gegenüber vom Infostand am Haupteingang befindet sich das Restaurant „La Fabbrica“: Wer einen Blick auf die an der Zugangstreppe postierte Speisekarte wirft, entdeckt darauf eine „Pizza PermaFungi“ – eine mit Bio-Austernpilzen, so die Erläuterung, die hier im Gebäude gewachsen seien, und zwar auf Kaffeesatz aus eben diesem Restaurant.
Jetzt eilt er zum Treffpunkt herbei, Julien Jacquet, der Kopf von PermaFungi, einer kleinen Kooperative, die es – anders als sonst oft bei urbanem Gartenbau – nicht auf Dächern oder Hochbeeten sprießen lässt, sondern in einem Keller. „Pilze mögen es die meiste Zeit kühl und dunkel“, sagt Jacquet, 35, „insofern haben wir hier unten in den Katakomben gute Bedingungen.“
Jetzt, am späten Nachmittag, sei allerdings die meiste Arbeit getan, vielleicht solle man erst mal einen Kaffee trinken, gleich um die Ecke im Gebäude, bei Le Pain Quotidien. Die belgische Bäckerei-Restaurant-Kette, ein Biobetrieb wie PermaFungi, ist 2017 eine Partnerschaft mit den Pilzzüchtern eingegangen. Seitdem wird in sämtlichen Brüsseler Filialen der feuchtbraune Kaffeesatz, der nach der Zubereitung von Espresso oder Filterkaffee übrig bleibt, nicht entsorgt, sondern Jacquets Start-up zur Wiederverwertung überlassen.
„Kaffeesatz in den Mülleimer zu werfen ist eine gigantische Verschwendung“, sagt er, dann nippt er hastig an seinem Cappuccino, um schnell, eindringlich, ja fast atemlos über die Idee des 2014 gegründeten Unternehmens weiterzusprechen. „Unser Ansatz ist inspiriert von der Natur. Dort ist der Abfallstoff der einen Pflanze Nährstoff für eine andere“, sagt er. „Wir sollten deshalb Kaffeesatz nicht als Müll, sondern als Ressource begreifen. Allein in Brüssel fallen 15.000 Tonnen Kaffeesatz pro Jahr an.“
Jacquet erhebt sich von seinem Stuhl und zeigt auf eine Empore. „Sehen Sie die Leuchten dort oben? Sie bestehen zum Teil aus einem Material, das aus unserem Kaffeesatzsubstrat hergestellt wird, und sind biologisch abbaubar.“ Die federleichten, gelbbraun gefleckten Lampenschirme seien auf Initiative von PermaFungi entstanden, bei der Entwicklung auch solcher Produkte des Alltaggebrauchs mache man große Fortschritte. Langfristig könne Kaffeesatz helfen, Plastik zu ersetzen. Das Kernprodukt der Firma jedoch bleibe das, was sie im Namen trägt und mit dem alles begann: Pilz, lateinisch fungus.
Wie Permakultur und PermaFungi zusammenfanden
Im Jahr 2013 machte sich der belgische Bioingenieur Martin Germeau mit dem Fahrrad zu einer Asienreise
auf, landete schließlich in Thailand, wo er auf einer Farm mithalf, die sich der Permakultur verschrieben hatte – einer Wirtschaftsform, die mit der Natur und nicht gegen sie arbeitet, indem sie Ressourcen nachhaltig und schonend einsetzt. Dort sah er, wie man Kaffeesatz nutzte, um Pilze zu produzieren – und brachte die Idee mit zurück nach Belgien.
Zur selben Zeit besuchten drei junge Brüsseler einen Vortrag von Gunter Pauli, einem Landsmann, der in seinem 2010 erschienenen Buch „The Blue Economy” eine radikale Vision des Wirtschaftens entworfen hatte: Nicht weniger Müll zu produzieren sei das Ziel, sondern Fertigungsprozesse zu entwerfen, bei denen überhaupt kein Müll mehr entsteht. Eines der Beispiele, die Pauli anführte, war die Pilzzucht auf Kaffeesatz. Germeau und das Trio fanden zusammen. Mitstreiter kamen hinzu. PermaFungi war geboren.
Dass sich Kaffeesatz als Dünger eignet, wissen Pflanzenfreunde schon lange. Schließlich enthält er mit Stickstoff, Phosphor und Kalium viele Nährstoffe. „Meine Eltern nutzen ihn seit jeher bei der Gartenarbeit“, sagt Julien Jacquet. Offensichtlich hat sich unter Hobbybotanikern herumgesprochen, dass gerade der schmackhafte Austernpilz nicht nur Holz und Stroh als Substrat schätzt, sondern auch gebrauchtes Kaffeemehl. Im Internet findet sich eine Vielzahl von Anbietern, bei denen man Sets bestellen kann, um zu Hause Pilze zu züchten. Auch PermaFungi vertreibt Behälter samt Deckel und Saatgut, in denen Käufer Kaffeesatz sammeln und verfolgen können, wann daraus die ersten Speisepilze sprießen.
Der vermeintliche Abfall, von dem jedes Jahr weltweit gut sechs Millionen Tonnen anfallen, wird immer häufiger auch als Upcycling-Material entdeckt: Die Berliner Firma Kaffeeform etwa presst daraus Espresso- und Milchkaffeetassen sowie Coffee-to-go-Becher; der britische Desig- ner und Recyclingexperte Adam Fairweather hat Tischplatten und Sitzflächen von Stühlen entworfen, die zu 60 Prozent aus Kaffeesatz bestehen. Die kalifornische Firma Domestic Stencilworks bedruckt T-Shirts mit Farbe, die aus Kaffeesatz gewonnen und mit Essig fixiert wird, und beim Mode-Label Rumi X in Hongkong entsteht aus Kaffeesatz und recycelten Plastikflaschen funktionale Sportbekleidung. „Noch ist es ein kleines und sehr junges Geschäftsfeld“, sagt Kaffeeform-Gründer Julian Lechner, „aber vieles deutet darauf hin, dass Kaffeesatz schon in wenigen Jahren im großen Stil recycelt werden könnte.“
Das Myzel macht sich über den Kaffeesatz her
Julien Jacquet führt über eine Treppe vor dem Restaurant La Fabbrica hinab zu den Produktionsräumen von PermaFungi, es geht durch dunkle, endlos erscheinende Gänge, die auf beiden Seiten gesäumt sind von mächtigen, mit Eisenstangen verriegelten Holztoren, hinter denen früher Güter lagerten. Jacquet biegt ein letztes Mal ab und plötzlich tut sich ein großer Raum auf. Abgewetzte Ledersofas, Europaletten als Tische stehen hier herum, an den Wänden sind Vorhänge mit psychedelischen Pilz-Motiven. Fast könnte man diesen Ort gemütlich nennen, aber dazu müsste er wärmer sein.
An diese Vorhalle angeschlossen sind die elf Produktionsräume. Dazu muss man wissen, gezüchtet werden Pilze nicht auf purem Kaffeesatz. Es wird ein Basis-Substrat gemischt. Etwa zur Hälfte kommt Stroh von einem Ökobauernhof hinzu, dazu eine kleine Menge an Pilzkulturen, das Myzel. Die Mischung wird dann in schwarze Plastiksäcke gefüllt, so groß wie ein Boxsack. Diese Beutel hängen Mitarbeiter von Jacquet anschließend in den Nachbarräumen auf, wo sie zwei Wochen in Dunkelheit verbringen. „Während dieser Phase, wir nennen sie Inkubation, macht sich das Myzel über den Kaffeesatz her“, erklärt Jacquet.
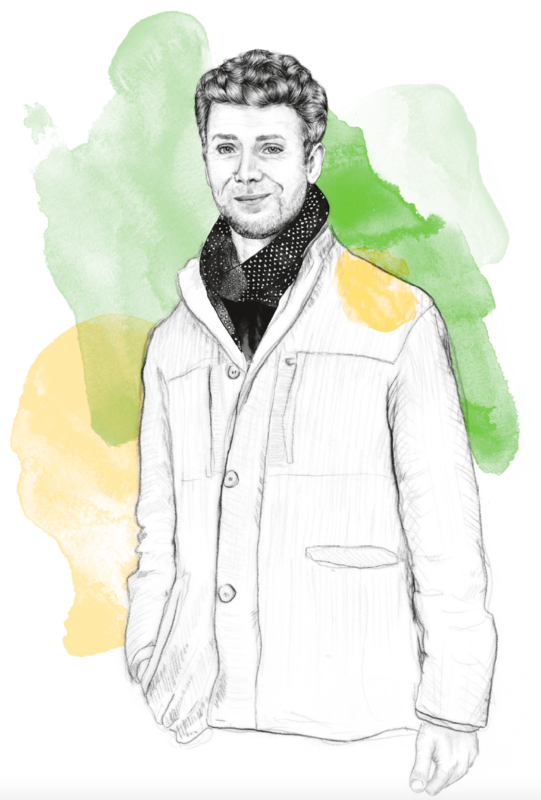
Einer der Säcke fällt optisch aus dem Rahmen, außen ist er durchsichtig, innen weiß. So kontrolliert das Team, ob sich im Beutel unerwünschte Pilze bilden. Weiß bedeutet: alles in Ordnung. Zeigen sich grüne, rote oder orangefarbene Stellen, ist der Raum kontaminiert und eventuell die ganze Charge betroffen. „Laut unserem Produktionsleiter kommt das bei 25 Chargen pro Monat vielleicht zweimal vor“, sagt Jacquet. Kunststoff sei nicht ihr Wunschmaterial, am Anfang habe man organisch abbaubare Säcke verwendet. „Aber die wurden von der Pilzbrut aufgefressen, und der Inhalt landete auf dem Boden. Wir müssen weiter nach einer guten Lösung suchen.“
Nach vierzehn Tagen, der Pilz hat sich inzwischen im gesamten Beutel ausgebreitet, kommen die Säcke für den dritten und letzten Produktionsschritt in die sogenannten Fruktifikationsräume. Dort ist es hell, nun werden rundherum Löcher in die Säcke gestochen, aus
denen die Pilze nach etwa einer Woche ans Licht drängen. Im ersten Raum sind die Exemplare, die aus den Beuteln quellen, noch ganz klein, im nächsten schon etwas größer, und im letzten Raum haben sie den für Austernpilze typischen trichterförmigen Hut ausgebildet. Diese Pilze sind drei Tage alt. Eine Nacht noch im Kunstlicht, dann können sie geerntet werden.
William Donck, 28, kümmert sich darum, dass innerhalb dieses drei- bis vierwöchigen Prozesses nichts schiefläuft. Der Bioingenieur leitet die Produktion, wie kein anderer erzielt er durch minimalen Einsatz von Technik zufriedenstellende Ergebnisse. Mit lebenden Organismen zu arbeiten sei immer kompliziert, sagt er. „Man kann zwei gleiche Samen an dieselbe Stelle im Raum setzen, und sie werden sich nie völlig gleich entwickeln.“ Bei PermaFungi sei die Sache besonders heikel, weil man sehr wenig Kontrolle ausübe, die betreffenden Parameter kaum steuere. „Wir haben einen Pasteurisierer für den Kaffeesatz, der ist unverzichtbar. Aber wir haben kein Kühlsystem und keine Heizung – wir wollen von fossilen Brennstoffen weitgehend unabhängig sein.“
Ideal, so Donck, wäre eine konstante Temperatur von 16 Grad in den Kellerräumen. Stattdessen falle sie im Winter auf 10, im Sommer steige sie auf 25 Grad. „2018, als es so heiß war, hatten wir große Probleme. Wir haben dann bei den Austernpilzen auf eine andere Varietät umgestellt, sie nennt sich Pleurotus ostreatus florida, stammt aus Florida und wächst bei höheren Temperaturen.“

Eine andere Herausforderung sei die Luftfeuchtigkeit. Sie sollte in den verschiedenen Produktionsräumen unterschiedlich sein, um dem jeweiligen Wachstumsstadium der Pilze gerecht zu werden – am Anfang höher, am Ende niedriger. „Weil wir aber nur eine einzige Pumpe haben, mit der wir Wasser vom Dach in die Produktion sprühen, ist die Feuchtigkeit überall gleich.“ Das Befeuchten geschieht keinesfalls automatisch, Donck verlässt sich auf sein Gespür. Erscheint ihm das Klima zu trocken, aktiviert er die Pumpe. Fingerspitzengefühl muss er auch
bei der Belüftung der Räume beweisen. „Pilze atmen, deshalb müssen wir ihnen genügend Sauerstoff zuführen. Das kann, wenn es draußen sehr kalt oder sehr warm ist, wiederum zu Problemen mit der Temperatur führen.“
So schmecken Pilze nach Pilzen, nicht nach Kaffee
Am nächsten Morgen ist im Vorraum der Produktion eine prächtige Ernte zu bestaunen. Sie liegt, vor wenigen Minuten von den Säcken getrennt, in blauen Kisten. Davor sitzt ein junger Mann mit Kapuzenpulli und schneidet die Pilze zurecht. So skurril sie an den Plastikbeuteln wirkten, so vertraut und appetitlich sehen sie nun aus. Jacquet kommt hinzu, ermuntert den Besucher zu probieren. Knackig, saftig, köstlich sind die Pilze. Kaffeenoten schmeckt man nicht heraus. „Uns haben Leute gefragt, ob man vielleicht nicht einschlafen könne, wenn man die Pilze abends esse“, sagt er. Nein, das Substrat habe auf das Aroma keinen Einfluss, es spiele auch keine Rolle, ob die Reste aus feinem Espressomehl oder grobem Filterkaffee stammen, ob aus Arabica- oder Robusta-, brasilianischen oder afrikanischen Kaffeebohnen.
Warum man sich auf Austernpilze spezialisiert habe? Weil sie sich zu deutlich höheren Preisen vermarkten ließen als Champignons, das sei einer der Gründe, sagt Jacquet. Bis zu 17 Euro zahlen Kunden für das Kilo; andere Bioanbieter böten ihre Ware zwar fünf Euro günstiger an. „Die meisten in Belgien verzehrten Pilze kommen aber aus dem Ausland. Unser Vorteil dagegen ist: Frische. Die macht den Geschmack aus.“
Bereits mittags erreicht die morgens geerntete Ware die ersten Kunden, dazu gehören neben den Le-Pain-Quotidien-Bistros nicht nur fast alle Bioläden der Stadt, sondern zum Beispiel auch die Kantine der Brüsseler Axa Bank. Ausgeliefert wird mit einem Vehikel, das im Vorraum parkt, ein Lastenfahrrad, auf dessen Vorbau das PermaFungi-Logo prangt – eine aufrecht stehende Kaffeebohne mit einem grünen Pilzhut darüber. „Wir liefern aus und holen gleichzeitig den Kaffeesatz unserer Partner ab“, sagt Jacquet, „so fahren wir nie leer.“ Über das Thema E-Bike habe man in der Belegschaft mehrfach diskutiert, sagt Jacquet. „Aber wenn die Leute unsere Fahrer unterwegs ansprechen, zollen sie ihnen immer wieder Respekt dafür, dass wir so konsequent sind und jeden unnötigen Energieverbrauch vermeiden.
Die Mengen, die PermaFungi-Mitarbeiter während ihrer mehrstündigen Fahrradtour transportieren, sind Jahr für Jahr gestiegen. 2015 waren es noch 200 Kilo Austernpilze pro Monat, 2016 schon 500 Kilo, seit 2017 produziert man monatlich eine Tonne. Zwischenzeitlich war ein weiteres Produkt hinzugekommen, von dem die Firma ebenfalls jeden Monat 1000 Kilo erntete: Chicorée. „Wir hatten festgestellt, dass das, was im Beutel nach der Pilzernte übrig bleibt, ein idealer Nährboden für Chicorée ist“, sagt Jacquet, „er liebt den Kaffeesatz-Kompost geradezu.“ Mit der Doppelproduktion konnte Permafungi fünf Tonnen Kaffeesatz pro Monat gleich zweimal in einen neuen Rohstoff verwandeln. Doch im März musste das Unternehmen den Chicorée-Anbau einstellen, weil man aufgrund zu niedriger Marktpreise nicht konkurrenzfähig war. Bei allem Idealismus – gerade Jacquet weiß, dass sich eine Sache rechnen muss, wenn sie Zukunft haben soll.
Als er Ende 2015 zum Team stieß, befand sich das Projekt in der Krise. Zwar funktionierte die Technik, aber niemand bezog ein Gehalt. Den Gründern ging langsam die Puste aus. „Wenn man die Welt retten will, aber das Konto ist immer auf null, hat man ein Problem“, sagt Jacquet. Der Wirtschaftsingenieur wurde von der Belegschaft zum „Administrateur délégué“ gewählt, einer Art Bevollmächtigter des Kollektivs, und nutzte fortan seine Kontakte zu Investoren, die soziale Projekte fördern.
Er setzte auf Wachstum und sorgte dafür, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten: So hat die Firma zum Beispiel nach dem Wechsel von einem kleinen Privatkeller in die Tour-&-Taxis-Katakomben anfangs keine Miete gezahlt. Damals war der größte Teil des Kellers ungenutzt, und Jacquet kannte jemanden vom Gebäudemanagement, der die Gründer mit der verrückten Idee dort machen ließ. Inzwischen leben zwölf Mitarbeiter vom Projekt, zwei Stellen davon finanziert der Staat, jeweils für die Dauer eines Jahres. „Da geben wir Leuten ohne Ausbildung eine Chance“, sagt Jacquet. Wie Mike, 29, der morgens die Pilze geschnitten hat. Es ist seine erste feste Anstellung.
Die partizipatorische Firmenstruktur gehört zur Firmenidee von PermaFungi wie die Pilze selbst. Alles wird in der Gruppe diskutiert und gemeinschaftlich entschieden, wer welche Aufgabe wie lange übernimmt, auch, wie viel Geld dafür gezahlt wird. Die Gehaltsunterschiede sind gering. Jacquet verdient am meisten, aber nur anderthalbmal so viel wie der Mitarbeiter mit dem niedrigsten Lohn.
Nun soll die Idee in die Welt getragen werden
Mittagessen im La Fabbrica: Nachdem die wirklich gute Pizza mit den Kellerpilzen probiert ist, kommt die Restaurantchefin, Bilitis Scaramuzza, 41, an den Tisch. Zunächst lässt sie ausrichten, ihr Küchenchef sei begeistert von den Austernpilzen. Die Konsistenz, schwärme der, sei fester, und es trete anders als bei herkömmlicher Ware viel weniger Wasser beim Braten aus. „Sie sind nicht billig, doch die Mehrausgabe lohnt sich“, sagt sie. Ihr selbst aber sei die Idee des Start-ups, die Verwertung von Kaffeesatz, so wichtig wie die Güte des Produktes. „Als ich mitbekam, was die da unten im Keller treiben, fand ich
es sofort spannend. Damals hatten wir noch keinen organisch angebauten Kaffee im Ausschank – der ist aber Voraussetzung, um PermaFungi den Kaffeesatz überlassen zu können. Also habe ich auf Biokaffee umgestellt.“
Für Julien Jacquet sind diese Erfolge kleine Schritte zur Erfüllung seiner Mission. „Paris, Hamburg, New York: Wir wollen die Idee dorthin tragen, andere Leute sollen dort dasselbe aufziehen. So kann ein dezentrales Netzwerk entstehen.“
Deshalb bietet PermaFungi dreitägige Schulungen an, in denen den Teilnehmern alle Produktionsschritte erklärt werden. Im vergangenen Jahr habe man das Know-how an etwa sechzig Leute weitergegeben, sagt Jacquet. Man mache den potenziellen Firmengründern keinerlei Vorgaben. Wenn zwei Kanadierinnen aus Montreal, die sein Team geschult hat, ihre Pilze und den Kaffeesatz in einem Pick-up mit Benzinmotor transportieren, sei das deren Sache. „Wir urteilen nicht über andere.“
Aber zieht man sich auf diese Weise nicht Konkurrenz heran? Einerseits schon, sagt Jacquet. Aber man expandiere auch selbst: In diesen Tagen starte die erste PermaFungi-Zweigstelle im 50 Kilometer südlich von Brüssel gelegenen Charleroi. „Außerdem ist uns ein lebendiger Markt mit vergleichbaren Anbietern recht: Erstens rückt so das Thema ins öffentliche Bewusstsein. Zweitens konkurrieren wir lieber mit Leuten, die so arbeiten wie wir, als mit Billiganbietern aus anderen Ländern.“ Sorgen müsse er sich ohnehin nicht machen, findet Jacquet.
Warum?
„Weil wir einfach gut sind in dem, was wir tun, und
Gutes im Sinn haben.“ //
Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.