Lieben und lassen
Ein Kind zu einem glücklichen, mündigen Menschen zu erziehen ist eine große Aufgabe. Antje Joel, Mutter von sechs Kindern, hat dabei viel über Verantwortung gelernt.
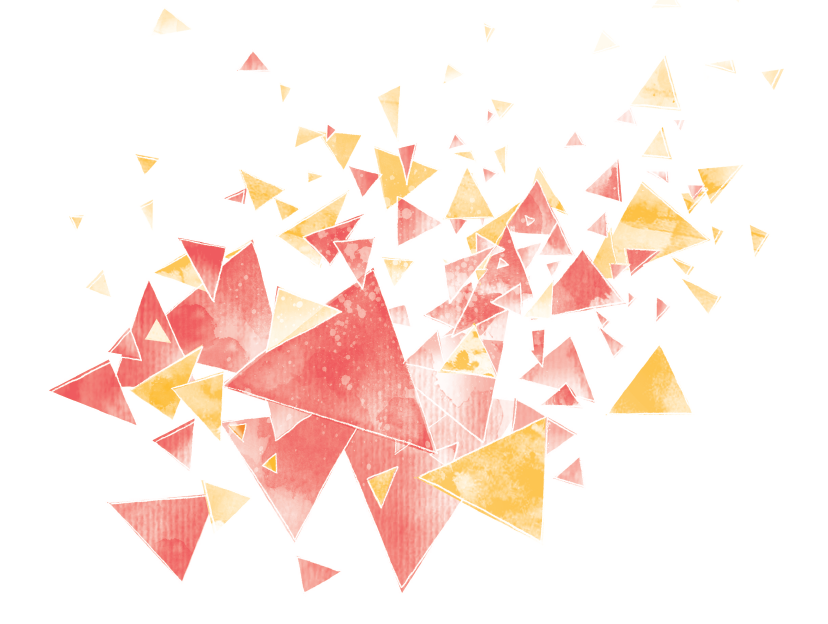
// Ich soll etwas darüber erzählen, wie man seine Kinder Verantwortung lehrt? Ich fürchte, das grenzt an Hochstapelei. Klar, theoretisch sollte ich etwas darüber wissen. Bestenfalls eine Menge, an der Zahl und dem Alter der Kinder gemessen. Ich habe sechs. Mittlerweile alle erwachsen. Sie klauen keine Autos (mehr) und bewerfen (nicht länger) die Fenster von Nachbarn mit Eiern. Ein paar von ihnen sind tätowiert, aber das verkrafte ich inzwischen. Selbst das Kind, das als Vierjähriger mit den Familienhunden in einer Höhle im Garten lebte und sich erst weigerte, in den Kindergarten zu gehen und dann in die Schule, weil das der Anfang vom Ende sei – er sagte damals zu seiner Schwester: „Danach musst du arbeiten, arbeiten, arbeiten! Das mache ich gar nicht erst mit!“ – studiert nun im sechsten Semester Chemie.
Ob aus den Kindern wegen oder trotz meiner Erziehung etwas geworden ist? Darüber lässt sich streiten. Das tun die Kinder und ich bisweilen auch.
Verantwortung – ich habe heute noch meine Schwierigkeiten mit dem Wort. Genau wie ich mich bisweilen schwertue mit dem Begriff Disziplin. Ich meine nicht auf diese „Hey-ho, schaut her, wie aufregend anders und herrlich verwegen ich bin!“-Möchtegern-Piraten-Art. Ich meine es auf eine verlorene, ziemlich schmerzhafte Art. Ich stehe auch auf traurigem Kriegsfuß mit Ordnung. Und Anstand. Es ist mir so gut wie unmöglich, pünktlich zu sein. Das hat nichts damit zu tun, dass ich, wie meine (noch immer!) an mir verzweifelnden, stets auf die Sekunde pünktlichen Eltern vermuten, mich nicht genug bemühte. Das Gegenteil ist die Regel: Je mehr ich mich bemühe, pünktlich zu sein, desto später bin ich.
Ähnlich geht’s mir mit der Ordnung. Und mit der Sauberkeit. Alle paar Monate, wenn ich es nicht mehr ertrage und mich aufraffe, gegen das Chaos in meinem Zimmer, in der Küche, in der Wäschekammer anzuputzen, zu wischen und zu saugen, stundenlang, schwöre ich mir, es nie wieder so weit kommen zu lassen. Ich muss es nicht extra schreiben – wir wissen, wie das endet. Ich kann auch nicht mit Geld umgehen. Wenn ich mal welches habe, ist es immer zu wenig.
Das sind einerseits denkbar schlechte Voraussetzungen, eigenen Kindern Verantwortung beizubringen. Oder eine verträgliche Form von Disziplin. Es sind schlechte Bedingungen, um sie zu ordentlichen, anständigen Menschen zu erziehen. Andererseits: Gibt es dafür ein Rezept?
Meine Eltern zum Beispiel. Sie haben alles gegeben, sie marschierten immer mit bestem Beispiel voran. Meine Eltern sind nicht nur die allerpünktlichsten, sie sind auch die anständigsten, ordentlichsten, sparsamsten und saubersten Menschen, die ich kenne. „Vom Fußboden essen können“ – das ist für meine Eltern nicht nur eine Redensart. Es ist ein Lebenssinn. „Ich habe alles richtig gemacht!“, hat meine Mutter erst vor Kurzem zu mir gesagt. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Anlass. Ich glaube, das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass du alles richtig machst. Und dass du es immer richtiger machst als alle anderen. Auch das ist wichtig.
Als Kind und noch lange danach lähmten mich diese himmelhohen Anforderungen vor Angst. Dann und wann befällt sie mich noch heute. Neulich zum Beispiel, als mir, bei meinen Eltern zu Gast, ein paar Stücke brauner Zwiebelschale auf die makellos weißen Küchenfliesen fielen. Sie eiligst aufzuklauben, war ich außerstande. „Ich kann es nicht“, rief ich irgendwann erschöpft meinem viel jüngeren Bruder zu. Und wir wussten beide, ich meinte nicht die blöden Schalen. „Ich schaff‘ und schaffe es einfach nicht, diesem Standard zu genügen!“ Wir lachten. Obwohl wir natürlich wussten, wie wenig witzig das alles ist.
Zu einer Freundin habe ich mal gesagt: „Ich weiß nicht, ob meine Eltern mich jemals in irgendetwas anderem unterstützt haben als im Versagen.“ Da war ich Mitte 40 und konnte auch über diese Erkenntnis schon beinahe lachen. Jetzt, mit Mitte 50, ahne ich, unter welchem Stress meine Eltern ihr Leben lang standen. Welchen Terror die Begriffe Verantwortung und Disziplin, die ihnen von wem auch immer eingebläut worden waren, in ihnen auslösten.
Wie willst du deinen Kindern etwas vermitteln, von dem du niemals begriffen hast, was es ist? Weil dir keiner jemals die Freiheit gegeben hat, zu erkennen, was es sein könnte. Sein sollte. Im besten Sinne. Solange du das nicht begriffen hast, vermittelst du am Ende wieder nur den gleichen, seit Generationen mitgeschleppten Murks. So lange hältst du Verantwortung nur für die andere Seite von Schuld. Und Disziplin nur für ein anderes Wort für Drill. So lange klammerst du dich an das eine wie das andere nur als ein Mittel von Kontrolle. Von Macht. Über andere. Deine Kinder. Kollegen. Arbeitnehmer. Du denkst, nur so kommst du gegen deine Furcht vor Kontrollverlust und gegen das Gefühl von Machtlosigkeit an.
Was habe ich nur gedacht?
Ich war 18, als ich zum ersten Mal Mutter wurde. Mit Absicht. Warum? Ich war kaum alt genug, für mein eigenes Leben die Verantwortung zu übernehmen. Oder überhaupt zu begreifen, was das heißt. Was da auf mich zukam. Wenn ich’s begriffen hätte, hätte ich dann, einfach so, die Verantwortung für ein weiteres Leben übernommen? Ich glaube nicht. Die Schriftstellerin Lily Brett hat über ihr absichtlich sehr junges Mutterwerden einmal geschrieben: „Ich liege lächelnd in einem Krankenhausbett. Ich trage ein weißes viktorianisches Spitzennachthemd. Mein Haar ist in der Mitte gescheitelt. Ich halte meinen neugeborenen Sohn im Arm. Ich bin ein Bild heiterer Gelassenheit. Wer war ich? Ich war zweiundzwanzig. Und das ganze Chaos wurde (wie das mit zweiundzwanzig noch möglich ist) von Furchtlosigkeit überdeckt, von Unschuld, guter Haut, schönem Haar und der richtigen Lippenstiftfarbe.“ Ich lachte, als ich das las. Und ich fühlte ein schmerzhaftes Erkennen.
Was habe ich gedacht, als ich mein erstes Kind von der Entbindungsstation mit nach Hause nahm? Und dann, so über den Daumen gerechnet und für eine lange Zeit, alle drei Jahre ein neues. Ich muss geglaubt haben, das wird schon. Ich muss geglaubt haben, ich kann das. Sechs Kinder ernähren, kleiden, ihnen ein Dach über dem Kopf geben. Und mehr: sie zu verantwortungsbewussten, anständigen, ordentlichen Menschen machen. Was immer das hieß. Oder was immer ich dazu erklärte. Für meine Kinder. Für mich. Mein Vertrauen in meine Fähigkeiten zu eigenständigem, von der eigenen Aufzucht unabhängigem Denken, überhaupt und als Mutter, muss grenzenlos gewesen sein. Vielleicht war das Grenzenlose, das ich empfand, aber auch nur Angst.
Mein Zweitältester, mittlerweile 33, nannte meinen Erziehungsstil kürzlich „unfreiwillig antiautoritär“. Was er genau damit meinte, konnten wir noch nicht klären. Denn ehe wir uns versahen, lagen wir uns über dem Thema „Erziehung und wie sie bei uns so ablief“ an den Köppen. Wir wohnen 2000 Kilometer auseinander und sehen uns selten mehr als einmal im Jahr. Meist an Weihnachten. Dem Fest der Liebe und der Familie. Da darf man sich auf keinen Fall an die Köppe kriegen. Darum tun wir das dann. Jedes Mal. Natürlich nicht absichtlich. Im Gegenteil, wir nehmen uns jedes Jahr vor, die Streiterei beziehungsweise Themen, die sie auslösen könnten, nach Kräften zu vermeiden. Und so passiert‘s. Ich meine, wenn man auf Zehenspitzen herumschleicht, ist man doch oft am lautesten. Janosch beschrieb das Phänomen in „Polski Blues“, meinem Lieblingsroman von ihm, so: „Morgens in der Küche bemühte sich die Frau, so lange keinen Krach zu machen, bis endlich alle wach waren.“
Unfreiwillig antiautoritär. Ich glaube, das lässt sich, ohne mir unrecht zu tun, auf einen simplen Nenner bringen: Ich hatte keine Ahnung! Was ich wusste, war, dass ich als Mutter auf keinen Fall werden wollte, wie meine Eltern als Eltern gewesen waren. Was ich nicht wusste, war, dass das nicht zum Elternsein reicht. Und natürlich hatte ich, elterngleich, schreckliche Angst zu versagen. Was immer ich tat. Darum tat ich so wenig wie möglich. Und dann, wenn mir die Sache über den Kopf wuchs, schnell viel zu viel. Souveränität? Das konnte ich buchstabieren. Leben? Nicht.
Erziehungsratgeber hielt ich für Unfug. Auch das hatte ich von meinen Eltern übernommen. Ich dachte: Liebe! Das reicht. Alles Weitere wird sich dank ihr finden. Meine Bereitschaft, bedingungslos zu lieben, war das, was mich von meinen Eltern unterschied. Davon war ich überzeugt. Zwei, drei Jahrzehnte später, als ich meine Tochter, mit 19 Mutter geworden, fragte, warum sie so erschreckend furchtlos glaube, dass das alles kein Problem sei, sagte sie: „Weil ich mein Kind liebe.“ Ich dachte, na, schönen Dank auch. Ich sagte nichts.
Sie hätte mir eh nicht geglaubt, was ich heute weiß: Die Umsetzung dieser Theorie in die Praxis fällt nur am Anfang leicht. Solange die Kinder klein sind und anschmiegsam, solange du an ihre unbedingte Formbarkeit glaubst. Ist es mit der Anschmiegsamkeit vorbei, kommt es schnell zu den ersten „Verstößen“ gegen die Liebe-ist-alles-Regel. Von beiden Seiten.
Anfangs hielten die sich, wenn schon nicht in überschaubaren, dann aber doch in erträglichen Grenzen. Wer hat die Kekse gegessen? Immer die jeweils andere. Kannst du endlich den Abwasch machen? Warum immer ich? Später, als Eier gegen die Fenster der Nachbarn flogen, als eines der Kinder sich unerlaubt tätowieren ließ und ein anderes mit einem Auto herumfuhr, das ihm nicht gehörte, betrunken und ohne Führerschein, erlebte ich mich mit meiner Textbuch-Souveränität schnell am Ende. Liebe als Alleinerziehungsmittel hatte sich als nutzlos erwiesen. Gleiches galt für Vertrauen.
Stück für Stück loslassen
Ich ersetzte beides kurzfristig durch gnadenlose Kritik. Durch Drohungen. Und durch so sinn- wie nutzlose Strafen. Ich nannte sie erhaben Konsequenzen. Schließlich wollte ich, wie wir alle, für meine Kinder nur das Beste.
Ich bestand darauf, dass sie Verantwortung übernahmen. Für sich und ihr Verhalten. Ich wollte, dass sie selbstständig wurden. Ich erkannte die Notwendigkeit und den Nutzen. Ich fürchte nur, in erster Linie erkannte und forderte ich eine Notwendigkeit und einen Nutzen für mich. Ich ließ nicht die Vorstellung zu, was ihre Eigen-verantwortung und Eigenständigkeit in ihrer ganzen Konsequenz bedeuteten: dass meine Kinder mich Stück für Stück verließen. Dass ich Tag für Tag mehr an Einfluss verlor. An Kontrolle.
Meine Eltern hatten gewollt, dass ich früh selbstständig, dass ich eigenständig wurde. Das war ihnen wichtig. So hatten sie es gesagt. Ich bin sicher, sie glaubten das sogar. Und ich glaubte es ihnen. Heute denke ich, tatsächlich verlangten sie von mir, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Auf der von ihnen vorgegebenen Route.
Es ist beängstigend, die Kontrolle zu verlieren. Es tut weh loszulassen. Ich meine: richtig. Auf diese Art, wo du hinnimmst, dass der, den du loslässt, nie mehr zu dir zurückkommen wird. Nicht als der- oder diejenige, der er oder die sie mal war. Es ist nicht mehr dein Kind. Es ist sein eigener Mensch. Wenn’s gut geht, begegnet ihr euch auf neue, ganz andere Art. Das zulassen zu können, das abzuwarten, dafür braucht es Nerven. Ich hatte sie lange nicht. Ohne mir dessen bewusst zu sein. Ich dachte, ich ließ meine Kinder los. Tatsächlich ließ ich sie immer mal wieder fallen.
Disziplin, so hatte ich gelernt, war nur ein anderes Wort für Kontrolle. Und zunächst hatten die andere, und zwar über mich. Später bediente ich mich des Wortes, um meinerseits Kontrolle auszuüben. Verantwortung war nun die andere Seite von Schuld. Ich übertrug Verantwortung (zunehmend) dann, wenn ich nicht gewillt war oder mich nicht imstande sah, sie zu tragen. Ähnlich meinen Eltern, die mich 16-jährig in gefährlichste Umstände hatten ausziehen lassen. Mit den Worten: „Du übernimmst dafür die volle Verantwortung. Komm nicht an und beklag dich, wenn du auf die Schnauze fällst!“ Ich muss wie sie geglaubt haben, wenn ich Verantwortung übertrug, entlastete ich mich von Schuld.
Ich glaube, diesem selbstgefälligen Irrtum unterliegen viele Menschen. Und scheinbar immer mehr handeln danach. Staaten und ihre Oberhäupter eingeschlossen. Bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses antwortete der derzeitige US-Präsident und Irgendwie-Landesvater Donald Trump auf die Frage eines Journalisten, ob er Verantwortung für die Nachlässigkeit übernehme, mit der seine Regierung Millionen von Menschen in Lebensgefahr durch das Coronavirus gebracht habe: „Ich trage überhaupt keine Verantwortung.“ Er sagte es lächelnd und mit der größten Selbstgefälligkeit. Ohne auch nur eine Spur von Zweifel. Und seine Berater hinter und neben ihm zogen ihm nicht die Ohren lang. Sie lächelten und nickten beifällig. Warum auch nicht? Millionen Menschen hatten diesen Mann genau seiner Selbstgefälligkeit wegen gewählt.
Verantwortung übernehmen und tragen – das braucht Integrität. Und die Art gemessener, souveräner Loyalität, die aus Integrität erwächst.
Ich war schon 36, als ich einen traf, der mir eine Definition von Disziplin und Verantwortung anbot, mit der ich leben konnte. „Disziplin“, sagte er, „das ist das Bewusstsein dafür, dass du eine Verantwortung hast, zu tun, was zu tun ist.“ Er war 76 und Rancher in Idaho. Ich brauchte ziemlich lange, bis ich diesen Satz verstand, wie auch manch anderen, den er sagte. Viele, wenn nicht die meisten von ihnen, hatten mit Disziplin, mit Verantwortung zu tun. Das fand ich, obwohl ich damals für ihn arbeitete, zu meiner eigenen Überraschung nicht schlimm. Ich verstand: Er erwartete einfach nichts von mir. Und zwar im besten Sinne. Ob und was ich von ihm lernte, wie schnell und auf welche Art ich mir das womöglich Erlernte womöglich zu Nutzen machte, überließ er allein mir. Das war Souveränität. Es war Freiheit.
Einmal galoppierten wir einen Berg hinunter, und ich fiel vom Pferd. „Was ist passiert?“, fragte er, als ich, Pferd an der Hand, zu ihm hinüberhinkte. „Weiß nicht“, brummte ich. Er schaute amüsiert. „Wenn du nicht weißt, was passiert ist, wie willst du verhindern, dass es wieder passiert?“ Er lachte. „Ich werde dir sagen, was passiert ist. Dieses eine Mal nur. Das Pferd war schneller als du. Du hast es unter dir weglaufen lassen.“ – „Nein!“, sagte ich. Er sagte nichts. „Vielleicht“, knurrte ich. Er nickte. „Gut gemacht“, sagte er.
Ich verstand: Die Verantwortung, die er mir übertrug, war der flexible Maßstab für meine Möglichkeiten und meine Kompetenzen. Er ließ mich an ihr wachsen. Statt dass er mich mit ihrer Last zerbrach.
Ein anderes Mal hatte ich Schwierigkeiten, mein junges, noch grünes Pferd zu bewegen. Ich dachte, ich tat alles, um ihm zu helfen. Ich legte meine Beine sanft an seinen Bauch. Ich presste zaghaft mit meinen Hacken. Ich haute halbherzig mit dem Zügelende auf seinen Hintern. Ich glaubte, das Pferd sei schuld, dass es sich nicht rührte. Vielleicht war es dumm. Oder bockig. Der Alte am Zaun sah mir eine Weile zu. Dann sagte er: „Du hast Angst, dass er losgeht. Und du hast Angst, dass er nicht geht. Was also willst du, dass er tut?“ Heute denke ich, wie oft wir Eltern unsere Kinder auf genau diese Art lähmen, mit der ich damals mein Pferd lähmte.
Einmal kaufte ich doch ein Erziehungsbuch. Ich erinnere nicht mehr Zeitpunkt und Anlass. Aber es muss spät und ich wieder einmal sehr verzweifelt gewesen sein. Es war von dem inzwischen leider verstorbenen dänischen Familientherapeuten Jesper Juul. Den Titel, „Pubertät – Wenn Erziehen nicht mehr geht“, nahm ich wörtlich, stellte das Buch ungelesen in den Schrank und vergaß es. Schade. Kürzlich nahm ich es wieder hervor und fand darin (sinngemäß) den Satz: „Eigenverantwortung (die ja der Beginn und die Voraussetzung aller Verantwortlichkeit ist) kann nur übernehmen, wer Kontrolle über sein Leben hat.“ Um ein Haar hätte ich geweint. „Das, was du zuletzt lernst, ist meistens das, was du als Erstes hättest wissen müssen“, hatte der Rancher damals gesagt.
Meine Eltern wussten, dass aus mir „etwas werden“ musste. Für sie hieß das, ich musste werden wie sie. Anders wussten sie mit mir nichts anzufangen. Sie wissen es heute noch nicht. Sie trauen sich heute noch kaum je hinter ihrem Schutzschild aus Anstand und Ordnung hervor. „Ich habe alles richtig gemacht!“ Mit kaum einem Satz schaffst du eine größere, dauerhafte Distanz. Das ist das Traurigste. An dem Satz und an unserer Geschichte.
Meine Kinder sind groß, die Jüngste schon 21. Immer wieder mal quälen wir uns und einander mit dem alten Thema „Erziehung und wie die bei uns so ablief“. Damit, wie hilflos und verloren sie als Kinder oft waren. Und wie hilflos und verloren mein Umgang mit ihrer Hilflosigkeit und Verlorenheit war. Oft enden die Gespräche in Streit. Das ist schmerzhaft. Aber vielleicht ein Anfang. //
Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.