„Sie Verhinderer!“ „Sie Ignorant!“
Juristen und Ökonomen finden in Wissenschaft und Wirtschaft nur schwer zusammen. Die zwei Disziplinen arbeiten häufig an den gleichen Schnittstellen, beanspruchen aber beide die Poleposition. Beziehungsstatus: kompliziert.
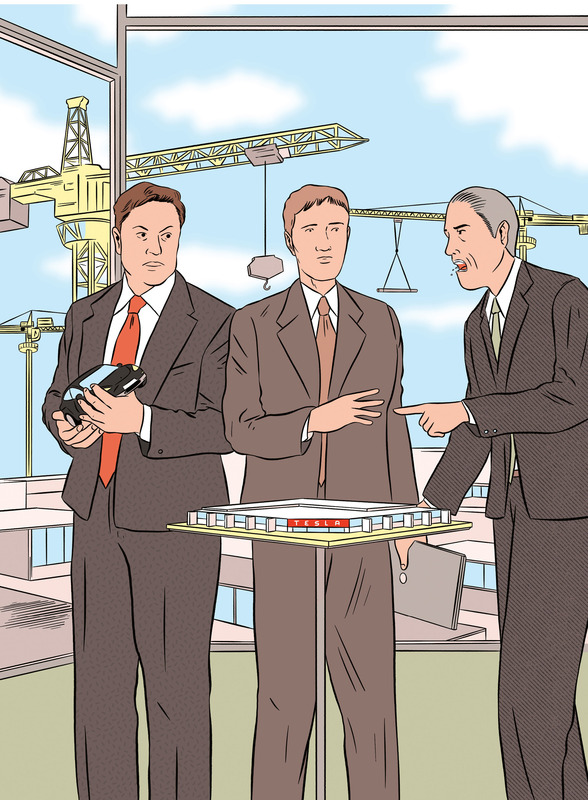
/ Drei brandenburgische Verwaltungsrichter haben sich kürzlich die wohl berühmteste und wunderbarste Sentenz des russischen Fabeldichters Iwan Andrejewitsch Krylow zur Maxime gemacht. „Ei, schau doch, was das Möpschen kann: Es bellt den Elefanten an!“, textete Krylow einst. Die Richter übernahmen die Rolle des Möpschens, die des Elefanten fiel keinem Geringeren als Tesla-CEO und Unternehmer-Ikone Elon Musk zu.
Um ein Haar hätte das Gericht die Eröffnung der neuen Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide verhindert. Am 22. März, dem „Delivery Day“, sollten unter den Augen von Elon Musk die ersten Autos aus dem neuen Werk an ihre Besitzer übergeben werden. Im Vorfeld gab es jedoch einen zähen Streit ums Wasser. Die Tesla-Fabrik, gelegen in einem wasserarmen Gebiet, benötigt ungeheure Mengen davon.
Die Richter gaben der Klage von zwei Umweltverbänden recht und befanden, dass die vor zwei Jahren mit Blick auf das Leuchtturmprojekt von Tesla ausgestellte Genehmigung zur Erhöhung der jährlichen Förderung von 2,5 auf knapp 3,8 Millionen Kubikmeter Wasser „rechtswidrig und nicht vollziehbar“ sei. Bei der Erhöhung der Fördermenge sei die Öffentlichkeit nicht ausreichend beteiligt worden – ein Verfahrensfehler. Der zuständige Wasserversorger, der sich außerstande sah, mit der geringeren Wassermenge sowohl die Bevölkerung als auch die Autofabrik zu versorgen, drohte postwendend mit der Kündigung des Vertrags mit Tesla. „Kein Tropfen Wasser für das Tesla-Werk“, titelte das Berliner Boulevardblatt B.Z.
Einige Tage sah es so aus, als könnten drei Provinzjuristen die bislang imageträchtigste Investition in Ostdeutschland ausbremsen. Erst fünf Tage vor dem Eröffnungstermin einigte sich die Landesregierung mit dem Wasserversorger. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird irgendwie nachgeholt, die 3,8 Millionen Kubikmeter Wasser dürfen nun doch gefördert werden. Und Tesla sitzt nicht auf dem Trockenen.
„Solche Fälle bestätigen das gängige Klischee, das die Wirtschaft gegen Juristen hegt“, kommentiert Peter Hettich, Professor für Öffentliches Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen: „Juristen sind die Bremser und Verhinderer.“ Unter genervten Managern kursiere die Sentenz: „Wenn du nicht willst, dass dein Projekt getötet wird, dann frage auf keinen Fall zuerst deine Rechtsabteilung.“
Erstens: Gerechtigkeit versus Effizienz
„Der preußische Assessor kann alles, sogar ein Kriegsschiff kommandieren“, sagte der damalige Bundespräsident Horst Köhler vor Jahren in einer Laudatio für Jutta Limbach, ehemals Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Der Satz, vermutlich noch aus der Zeit von Kaiser Wilhelm II. stammend, zeugt von einer gehörigen Portion Hybris. Die speist sich aus der Erkenntnis, dass Juristen, egal ob in Preußen oder später in der Bundesrepublik, als Allzweckwerkzeuge forsch die Schlüsselpositionen der Macht besetzten – in Politik und Verwaltung, aber auch in der Wirtschaft. So war der Vorstandsvorsitz großer Konzerne lange Zeit wie selbstverständlich meist von einem Juristen besetzt.
Die Ökonomen, im Vergleich zu den Rechtswissenschaftlern Emporkömmlinge ohne eine bis ins antike Rom zurückreichende Tradition, stemmten sich lange vergeblich gegen den Primat der Rechtsgelehrten, obwohl auch sie überzeugt waren, ein Anrecht auf die Poleposition in der Gesellschaft zu haben. Man müsse nur einen Großteil der hinderlichen Paragrafen über Bord werfen, den Rest besorge das ökonomische Prinzip quasi im Alleingang. Der Einzelne, angetrieben von egoistischen Motiven, vor allem vom Streben nach Profit, werde „von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, der keineswegs in seiner Absicht lag“ – so steht es schon bei Adam Smith, dem Begründer der modernen Nationalökonomie. Die aggregierten Egoismen führen demnach, zumindest auf lange Sicht, zur Wohlfahrt für alle. Wozu also braucht man dann all die Gesetze? Und die Juristen, die sie ersinnen?
Wie unvereinbar die Erkenntnisansätze sind, verdeutlicht das oft diskutierte Beispiel des Verbots der Folter. Ein Jurist, dem Ansatz der Pflichtethik folgend, wird eisern darauf beharren, dass nie und unter keinen Umständen gefoltert werden darf. Die Ökonomen dagegen, bei denen der Zweck so manche Mittel heiligt, werden die Folter im Ausnahmefall, wenn auch schaudernd, in Kauf nehmen – etwa wenn dadurch ein Terroranschlag mit Hunderten von Todesopfern verhindert werden kann. Hier die Gerechtigkeit, dort die Effizienz.
Ob ein Gesetz oder ein Urteilsspruch dazu führt, dass Unternehmen florieren oder pleitegehen, die Konjunktur boomt oder abstürzt oder eine Autofabrik pünktlich eröffnet werden kann, ist für den Juristen unerheblich. Das Gros der Ökonomen wiederum kann mit dem Begriff Gerechtigkeit nicht viel anfangen; er passt nicht in ihr Analyseschema.
Mischt sich die eine Disziplin in die Domäne der jeweils anderen ein, ist bisweilen ein gequälter Aufschrei zu hören. Insbesondere die Juristen sorgen sich um ihre Pfründe. „Ist die Ökonomie eine imperialistische Wissenschaft?“, heißt es orakelnd in Aufsätzen. Als sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) jüngst den marktliberalen Ökonomen Lars Feld als persönlichen Beauftragten ins Finanzministerium holte, wo traditionell die Juristen den Ton angeben, wurde das skeptisch beäugt.
Die Juristen stemmen sich nach Kräften gegen den „Einbruch der Ökonomie in das Recht“ und führen gern Fälle an, wo der zu völlig absurden oder moralisch verwerflichen Ergebnissen führt. Die Versteigerung von zur Adoption freigegebenen Babys etwa, die sich ökonomisch so begründen ließe, dass die Kinder auf diese Weise zu jenen Eltern kommen, denen sie am meisten wert sind. Oder das Räsonieren, ob es kostengünstiger ist, einen Todeskandidaten lebenslang einzusperren, als ihm nach schier endlosen Verfahrensschritten die Giftspritze zu setzen. „Das Recht ist nicht Handlanger der Ökonomie, sondern sollte diese in die Schranken weisen, wenn andere Werte als die bloße Wirtschaftlichkeit dies gebieten.“ Das sagt – natürlich – ein Jurist, der Schweizer Hochschullehrer und Wirtschaftsanwalt Peter Forstmoser.
Das Gros der Ökonomen kann mit dem Begriff Gerechtigkeit nicht viel anfangen; er passt nicht in ihr Analyseschema.
Juristen verloren an Boden
Dass Ökonomen und Juristen Hand in Hand zusammenarbeiten können und dabei Epochales zustande bringen, zeigt ein Rückblick auf die frühen Jahre der Bundesrepublik. Damals entwarfen Wissenschaftler der Freiburger Schule um den Ökonomen Walter Eucken und den Rechtsgelehrten Franz Böhm die Architektur der Sozialen Marktwirtschaft – mit einem von Politik und Recht gesetzten Ordnungsrahmen, der individuelle Freiheitsrechte, Wettbewerb, Privateigentum an Produktionsmitteln, Schutz vor Marktmacht, Vertragsfreiheit und Rechtssicherheit garantiert. Es sind Prinzipien, die bis heute gelten.
Das Recht pflügt aber nicht nur das Feld, das die Wirtschaft beackern darf, es bestimmt auch bei der Auswahl des Saatguts kräftig mit. Die Wirtschaft ist von der Juristerei durchtränkt – und zwar nicht nur von Arbeits-, Mitbestimmungs- und Kartellvorschriften: Das 13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes, das nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima das Ende der Kernkraft in Deutschland besiegelte, krempelte die gesamte Energiewirtschaft um. Die Corona-Hilfen des Bundes bewahrten ganze Branchen vor dem völligen Kollaps.
In anderen Fällen wiederum kann das Recht mit dem Tempo der Wirtschaft überhaupt nicht Schritt halten und hechelt hinterher – etwa beim Lieferkettengesetz, das die Zerstörung der Umwelt, Kinderarbeit sowie ausbeuterische Arbeitsbedingungen entlang globaler Lieferketten eindämmen soll.
Zudem beeinflusst das Recht die Verteilung wirtschaftlicher Macht – im Unternehmen und in der gesamten Wirtschaft. Es folgt dabei oft dem politischen Zeitgeist. Das Bundesarbeitsgericht beispielsweise, heute mitunter ein Bollwerk gegen Übergriffe der Arbeitgeber, erwarb sich in der Adenauer-Zeit unter seinem Präsidenten Hans Carl Nipperdey den Ruf der Arbeitgeberhörigkeit. In dieser Zeit zeigte es sich hart gegen Gewerkschaften, mit Grundsatzentscheidungen zur Einschränkung des Streikrechts, für die sofortige Entlassung ausgesperrter Arbeitnehmer und ein Recht auf Schadensersatz für bestreikte Firmen – mit der Folge, dass Gewerkschaften sich plötzlich mit Millionenforderungen der Unternehmer konfrontiert sahen.
Mit der Zeit entfernten die beiden Disziplinen sich immer weiter voneinander. Juristen flüchteten sich in die Spezialisierung und ließen die Gesetzgebungsmaschinerie auf Hochtouren laufen. Ökonomen, vornweg die Volkswirte, trieben die Mathematisierung ihrer Wissenschaft auf die Spitze. Im akademischen Betrieb war der jeweils anderen Disziplin maximal der Status einer lästigen Hilfswissenschaft vergönnt. Ein oder zwei Pflichtscheine, mit „ausreichend“ bestanden – dann konnten die angehenden Juristen und Ökonomen das Gedankenreich der anderen Fakultät komplett ausblenden.
Allerdings mussten die Juristen erleben, wie immer mehr ihrer einstigen Bastionen fielen, gerade in der Wirtschaft. Ein Bedeutungsverlust, der sich lange andeutete.
Wolfgang Däubler, die Galionsfigur des gewerkschaftsnahen Arbeitsrechts in Deutschland, erinnert sich noch gut an die vorherrschende Sicht der Juristen auf die Ökonomen, als er 1958 sein Jurastudium begann: „Was die dürfen, bestimmen letztlich wir – so sahen wir das.“ Schon zehn Jahre später, mit der 68er-Bewegung, war die beherrschende Stellung seiner Zunft ins Wanken geraten. „Da analysierte man plötzlich die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die Machtverhältnisse. Kaum jemand hat sich noch dafür interessiert, was die Juristen meinen, was man darf und was man nicht darf.“
Das gilt mittlerweile auch für die Chefetagen großer Unternehmen. „Juristen sind Auslaufmodelle“, heißt es in einer Auswertung der Personalberatung Odgers Berndtson. Danach sank der Anteil der Juristen unter den Vorständen der Dax-30-Unternehmen zwischen 2005 und 2021 von 15 auf sechs Prozent. Die Wirtschaftswissenschaftler, insbesondere die Betriebswirte, haben demnach mit 61 Prozent der Vorstandsposten klar die Regie übernommen. Die Juristen, so der Schweizer Wirtschaftsrechtler Peter Hettich, „haben es übertrieben mit ihrer Spezialisierung und können die Schnittstellen nicht mehr besetzen“. Am Ende bleibe für sie – zumindest in der Wirtschaft – nicht mehr viel übrig. „Dann sind sie die Handwerker im Dienst der Mächtigen und dürfen deren Entscheidungen in anwendbares Recht umgießen.“
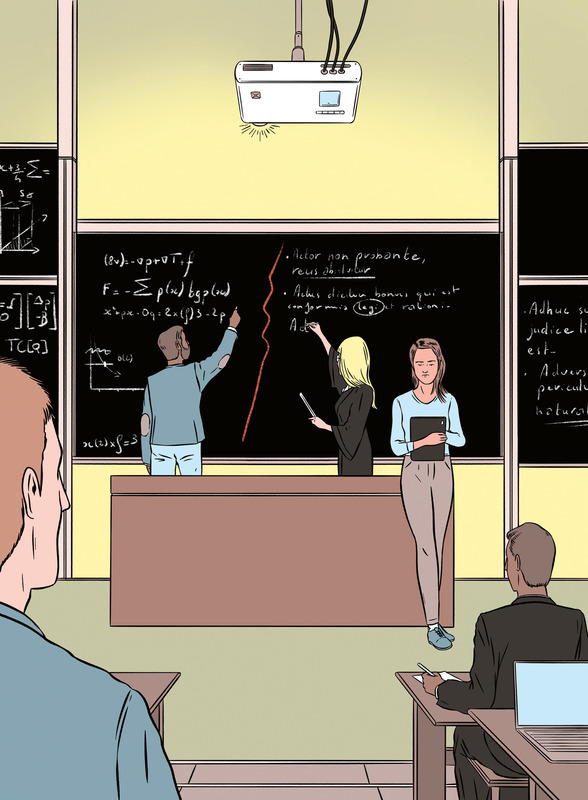
Zweitens: Versuche der Verständigung
Denkt Daniel Zimmer an seine Zeit als junger Juraprofessor in Bochum und Bonn zurück, an die 1990er- und frühen 2000er-Jahre, fallen ihm denkwürdige Diskursversuche mit Kollegen der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ein. „Die Ökonomen schrieben Formeln an die Tafel, mit denen die Juristen nichts anfangen konnten“, erzählt Zimmer, heute geschäftsführender Direktor des Center for Advanced Studies in Law and Economics an der Universität Bonn. „Die Juristen wiederum schleuderten lateinische Begrifflichkeiten um sich, von denen die Wirtschaftswissenschaftler noch nie etwas gehört hatten.“
Derartige Erlebnisse bereiteten den Nährboden eines vor gut zehn Jahren von Zimmer und einigen Kollegen kreierten neuen Studiengangs an der Bonner Universität. „Law and Economics“ lässt Recht und Ökonomie – zumindest in der Lehre – verschmelzen.
Jährlich versuchen sich 30 Studierende vom ersten Tag des Studiums an als Vermittler der juristischen und ökonomischen Sichtweisen. „Wir haben uns damals gesagt, dass wir radikaler sein müssen als jede andere deutsche Universität“, sagt Daniel Zimmer. „Man darf mit der Injektion einer kräftigen Dosis Ökonomie ins Recht nicht erst warten bis zur Spezialisierung im Masterstudium. Bis dahin sind die Leute schon verbildet und für das ökonomische Denken verdorben.“
Auf fast die gleiche Idee waren Schweizer Professoren schon zehn Jahre früher gekommen. „Unternehmen und große Wirtschaftskanzleien berichteten immer wieder von großen Defiziten bei den jungen Juristen, wenn es darum ging, komplexe Probleme zu lösen, bei denen auch ökonomischer Sachverstand nötig war“, erinnert sich Peter Hettich, heute einer der beiden akademischen Leiter des Studienprogramms „Law and Economics“ an der Hochschule St. Gallen. „Über den Tellerrand ihrer Disziplin hinausdenken – dazu waren die Schweizer Juristen nicht in der Lage.“
Während die Schweizer Studierenden sich in Unternehmensbilanzen etwas besser zurechtfinden, verfügen die Bonner Absolventen über mehr Sattelfestigkeit in volkswirtschaftlicher Theorie. Der Bonner Studiengang führt bis zum Bachelor und erlaubt den Übergang in klassische rechts- oder wirtschaftswissenschaftliche Masterstudiengänge. Das Gros entscheidet sich für den Weg zum juristischen Staatsexamen.
In St. Gallen können die Studierenden gleich bis zum Master weitermachen – und haben dann die Zulassung zum Anwaltsberuf in der Schweiz in der Tasche, vergleichbar mit dem Zweiten Juristischen Staatsexamen in Deutschland.
Erfolgreiche Absolventen des Zweiten Juristischen Staatsexamens: 2019: 8034
Erfolgreiche Absolventen BWL (im Erststudium): 2019: 32.751
Erfolgreiche Absolventen VWL (im Erststudium): 2019: 2207
Für Grenzgänger:Bachelor of Laws im Studienfach Law and Economics Universität Bonn
Major Rechtswissenschaft mit Wirtschaftswissenschaft Law and Economics HSG, St. Gallen
Gesetze lesen – und Bilanzen
Integrationsseminare und „Verzahnungsveranstaltungen“, wie es der Nachwuchs selbst schon mal nennt, sollen die angehenden Juristen aus dem klassischen Silodenken führen und die Elfenbeintürme zum Einsturz bringen – damit sie, so ein Absolvent aus St. Gallen, „bei der juristischen Beratung einer Unternehmensfusion die vorgelegten ökonomischen Kennziffern auf Anhieb verstehen“. Oder beispielsweise das Kartellrecht überhaupt sinnvoll anwenden können. Dazu ist nur ein Jurist fähig, der mit den wirtschaftlichen Folgen einer marktbeherrschenden Stellung oder von Preisabsprachen mehr als nur oberflächlich vertraut ist.
Jüngstes Beispiel: die zögerlich bröckelnden Spritpreise an den Tankstellen, obwohl sich die Lage an den Rohölmärkten nach dem ersten Preisschock zu Beginn des Kriegs in der Ukraine schon wieder entspannt hatte. Schon war das Bundeskartellamt im Spiel – auf der Suche nach Preisabsprachen zwischen den Mineralölkonzernen.
St. Gallen bietet zudem einen Abstecher in die Wirtschaftsethik an; die Studierenden diskutieren, warum der Siegeszug der großen Plattformkonzerne wie Amazon hochproblematisch ist und schauen sich mit den Experten einer Großbank die Russland-Sanktionen an. Wie viele Ressourcen sollte ein Unternehmen einsetzen, um die Sanktionsvorgaben umzusetzen und nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen? Wie müssen die Strafen für Verstöße gestaltet sein, um wirklich abzuschrecken? Warum ist es ethisch geboten, die Sanktionen nicht zu unterlaufen?
Anreize statt Verbote
Eine exakte Statistik über die Karrierewege der Absolventen wird bislang weder in Bonn noch in St. Gallen geführt. Aus Alumni-Vereinen und anekdotischer Evidenz weiß man, dass sie in Wirtschaftskanzleien, Ministerien, Kartellbehörden und Unternehmensberatungen sehr gefragt sind. „Es hat die Karriere beschleunigt“, sagt Philipp Estermann, der sein Studium in St. Gallen vor zwölf Jahren abschloss und jetzt in London in der internen Rechtsabteilung eines großen amerikanischen Softwareunternehmens arbeitet. In seiner Referendarzeit bei einem Schweizer Bezirksgericht sei er dort der Einzige gewesen, der in der Lage war, eine Bilanz zu lesen. „Ich konnte das dem Richter dann erklären.“
Erste Versuche, Recht und Ökonomie in der Wissenschaft und im akademischen Lehrbetrieb zusammenzuführen, gab es – vor allem in den USA – in den 1960er-Jahren. Die Ökonomische Analyse des Rechts durchleuchtet Gesetze mit den Instrumentarien der Volks- und Betriebswirtschaft, sie prognostiziert die wirtschaftlichen Folgen von Gesetzesänderungen – und ihre Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen.
Das Ziel sind bessere Gesetze, die keinen Anreiz zur Verschwendung von Ressourcen bieten – ohne dass die Gerechtigkeit unter die Räder kommt. In Deutschland „umweht immer noch der Hauch des Exotischen“ diesen Ansatz, so der Magdeburger Wirtschaftswissenschaftler Roland Kirstein, hierzulande einer der nicht allzu zahlreichen Verfechter der Ökonomischen Analyse des Rechts.
Das Gros der Juristen sperrt sich gegen den Ritterschlag der schnöden Effizienz zum hehren Rechtsprinzip. Vom „Ausverkauf der Gerechtigkeit“ ist die Rede.
Dabei geizt die Literatur nicht mit Praxisbeispielen. Allen voran der effiziente Vertragsbruch: Jemand verkauft sein Auto nicht an denjenigen, mit dem er bereits einen Kaufvertrag abgeschlossen hat, sondern an einen anderen Interessenten, der ihm später deutlich mehr bietet. Durch den Vertragsbruch, eine krasse Verletzung des Grundsatzes „pacta sunt servanda“, der von Juristen hochgehalten wird wie eine Monstranz, stehen sich am Ende alle Beteiligten besser – sogar der geprellte Käufer, sofern er vom Verkäufer ein ordentliches finanzielles Trostpflaster erhält.
Selbst im Strafrecht hält die Ökonomie Einzug, zumindest als Gedankenexperiment. Ein Täter, beispielsweise ein Einbrecher, so die Modellannahme, wägt die zu erwartende Strafe, den Nutzen aus der Straftat und die Wahrscheinlichkeit der Überführung gegeneinander ab – und entscheidet sich dann rein rational für oder gegen die Tat.
Auch auf die Idee einer „gesellschaftlichen Nachfrage nach Straftaten“ wäre kein Jurist ohne ökonomischen Beistand gekommen. Natürlich ruft die Gesellschaft nicht nach Raubmord oder Kindesmissbrauch, aber sie muss entscheiden, wie viel Staatsgeld in Polizei, Justiz, Kriminalitätsprävention und Aufklärung fließen soll. Ganz sicher nicht alles, was die öffentlichen Haushalte hergeben – dann fehlte ja das Geld für andere staatliche Aufgaben. Der Nutzen nicht abgeschreckter, also stillschweigend zugelassener Straftaten besteht in neuen Kindergärten, Schulen und Straßen, in Hartz-IV-Geld und Coronahilfen.
Hier und da ist der rational handelnde Nutzenmaximierer der ökonomischen Theorie selbst in der Rechtsetzung angekommen. Beispielsweise im Verbraucherschutz: Dort setzen das Haltungsform-Label auf Fleischverpackungen (von Stallhaltung bis Premium) oder die Ernährungsampel, die den Gehalt an Fetten, Zucker und Salz signalisiert, auf den mündigen Konsumenten statt auf Verbote. Das Leitbild des kritischen, allseits informierten und rational seinen Einkaufswagen füllenden Verbrauchers kommt dem idealisierten Homo oeconomicus der volkswirtschaftlichen Lehrbücher erstaunlich nahe.
Ich kam halt aus der juristischen Welt und dachte: Um in den Unternehmen etwas durchzusetzen, brauchen wir vor allem das Recht.
Drittens: Im Maschinenraum
Die juristische Fachliteratur im Bücherregal von Kerstin Meindl hat Staub angesetzt. Die 44-jährige Volljuristin, 2. Bevollmächtigte der IG Metall in Freiburg im Breisgau, schaut kaum noch in die Bücher und Zeitschriften. Auch an ihrem Schreibtisch ist sie nur noch selten zu finden; viel lieber ist sie vor Ort in den Betrieben. Dabei hatte sie doch in der Geschäftsstelle anfangs ihren Ruf als Schreibtischtäterin weg.
Meindl hat eine bemerkenswerte Metamorphose durchgemacht. Als sie vor knapp zehn Jahren zur IG Metall nach Freiburg kam, wollte sie, gewappnet mit wissenschaftlich fundierter rechtlicher Expertise, die Sache der Beschäftigten in den Betrieben ausfechten. Der damalige Geschäftsführer nahm sie beiseite und sagte: „Schön, dass du da bist, aber in den Betrieben werden die Dinge nicht juristisch entschieden, sondern politisch.“ Sie habe das damals „überhaupt nicht verstanden“, sagt sie heute. „Ich kam halt aus der juristischen Welt und dachte: Um in den Unternehmen etwas durchzusetzen, brauchen wir vor allem das Recht.“
Das sei ein Irrtum gewesen. „Viel wichtiger sind der Wille und der Mut, Ängste zu überwinden, um Rechte überhaupt einzufordern. Diesen Mut zu stärken – darin sehe ich heute meine Aufgabe.“ Das Ziel ist das gleiche geblieben: dass Unternehmen Tariflöhne zahlen, Betriebsratsgründungen nicht behindern, Stammbeschäftigte nicht durch Leiharbeiter ersetzen. Doch dabei sei das Recht „nur ein Hilfsmittel unter vielen“. Heute ist es Meindl viel wichtiger, beim Warnstreik ein paar Hundert Leute vors Werkstor zu bekommen, als die Paragrafen des Betriebsverfassungsgesetzes mitsamt der einschlägigen Kommentierungen herunterbeten zu können.
Bei aller Lust an Agitation und Empowerment, weiß Kerstin Meindl, muss sie auch das Wohl des Unternehmens im Blick haben. Oft stehe „Wirtschaftlichkeit gegen Gerechtigkeit“. Eine Tarifbindung schmälert den Profit. Steht das Unternehmen solide da – kein Problem, dann soll es gefälligst Tariflöhne zahlen. Steht die Firma allerdings mit dem Rücken zur Wand, ist Sanierungs-Know-how mehr wert als Prinzipientreue.
Bei Litef, einem Freiburger Hersteller von Navigations- und Stabilisationslösungen für zivile und militärische Anwendungen, gelang der Spagat. Als das Unternehmen vor fünf Jahren 100 von 600 Jobs abbauen wollte, rief Kerstin Meindl gemeinsam mit ihren Gewerkschaftskollegen, dem Betriebsrat und externen Beratern die Belegschaft dazu auf, ein Zukunftskonzept mit einem Plan für neue Geschäftsfelder und Prozessverbesserungen zu entwickeln. Das Management setzte wesentliche Teile des Konzepts um; die Beteiligung der Belegschaft ist bei Litef seitdem fest verankert. Das Unternehmen steht heute gut da; der Personalabbau war schon bald vom Tisch. „Dass ich mich als Juristin mal so weit auf wirtschaftliches Terrain vorwagen würde“, sagt Meindl, „hätte ich mir früher überhaupt nicht vorstellen können.“

Recht, das Macht begrenzt
Johanna Wenckebach kämpft für das gleiche Ziel wie Kerstin Meindl, aber auf einem anderen Weg. Das geschriebene Recht ist für sie mehr als nur ein Hilfsmittel. Die Arbeitsrechtlerin kennt beide Seiten des Kampfes um das Recht in der Wirtschaft, Theorie und Praxis. Als Tarifsekretärin der IG Metall hat sie „hautnah erlebt, wie Arbeitgeber ihren Beschäftigten knallhart sagen, dass die Produktion ins Ausland verlagert wird, wenn sie aufmucken“.
Heute, als Wissenschaftliche Direktorin des Hugo Sinzheimer Instituts für Arbeits- und Sozialrecht der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zurück in der Forschung, hat sich eine Gewissheit in ihr noch weiter verfestigt: „Recht begrenzt die Macht wirtschaftlicher Akteure, die sie dadurch haben, dass sie über Kapital verfügen.“ Klarer kann ein Standpunkt kaum sein.
Ständig stößt sie auf Fälle, bei denen das Papier, auf dem die Gesetzestexte gedruckt werden, offenbar sehr geduldig ist. In der Fleischindustrie beispielsweise. Vorschriften zu Arbeitszeiten, Arbeitsschutz, Mindestlohn und Kündigungsschutz – viel zu oft Makulatur. „Weil die Machtverhältnisse so sind, wie sie sind.“ Wenn sie an der Hochschule unterrichtet und von solch beschämenden Zuständen erzählt, „dann sitzen da sehr viele angehende Juristinnen und Juristen mit großen Augen und können es kaum glauben“.
In ihrer Zeit als Tarifsekretärin saß Johanna Wenckebach bei Verhandlungen mitunter – meist auffallend gut gekleideten – Anwälten von Wirtschaftskanzleien gegenüber. Auch sie arbeiten an der Schnittstelle von Recht und Ökonomie, nur eben als juristische Hochpräzisionswerkzeuge in Diensten der Unternehmen. „Ich habe mal jemanden sagen gehört, dass wir im Wirtschaftsprozess so etwas sind wie ein Hochleistungs-Motoröl beim Auto“, erzählt Dirk Besse, Partner bei der Wirtschaftskanzlei Morrison Foerster. „Das fließt dorthin, wo es gerade Reibung gibt und verhindert, dass sich dort ein Kolben festfrisst.“ Eine Beschreibung, die ihm ausgesprochen gut gefällt.
Die Spezialisten sind gut dotiert, Stundensätze für Partner einer Sozietät von 400 Euro und mehr sind durchaus üblich. Trotzdem gibt man sich gern bescheiden – zumindest was den Einfluss auf wirtschaftliche Entscheidungsträger betrifft. „Als Wirtschaftsjurist wird man von seinen Mandanten täglich gefordert und wächst in eine Haltung hinein, in der man etwas demütig wird“, sagt ein Partner einer renommierten Wirtschaftskanzlei. „Ein Richter am Amtsgericht spricht Recht. Wir sind Diener des Rechts.“
Die Wirtschaftsanwälte sind nicht diejenigen, die einen Vorstandschef in eine waghalsige Übernahmeschlacht treiben. Sie sorgen dafür, dass die Verträge am Ende wasserdicht sind und jeder Überprüfung standhalten, dass der Mandant sich etwa bei einer Übernahme keine schwerwiegenden Risiken aufhalst und nicht später Schmiergeldzahlungen, Kartell- oder Embargoverstöße auftauchen.
Als willfährige Erfüllungsgehilfen des Managements sehen die Wirtschaftsanwälte sich allerdings nicht. „Ein Anwalt muss sich, wenn es um eine Transaktion geht, in der Vorstandssitzung hinstellen und sagen: Hier ist eine Red Flag!“, sagt Dirk Besse. „Da muss man auch mal Spaßverderber sein können.“ Und über den ökonomischen Sachverstand verfügen, eine andere Lösung vorzuschlagen. „Das erwarten die Vorstände.“
Ein Richter hat seinen Fall klar vor sich liegen. Der Sachverhalt liegt in der Vergangenheit, da gibt es nichts mehr zu rütteln. Ein Wirtschaftsanwalt dagegen kann, wenn der Mandant ihm vertraut, gestaltend tätig sein. Das eröffnet ihm Freiheitsgrade, die dem Richter, Staatsanwalt oder Strafverteidiger verwehrt sind. Ein Wirtschaftsanwalt sei durchaus nicht nur in der hinteren Mechanik tätig, erklärt der Jurist und Volkswirt Thomas B. Paul, Partner der Sozietät Hengeler Mueller: „Wenn wir von Unternehmensführern ins Vertrauen gezogen werden, schauen wir in die Herzkammern der Wirtschaft.“ //
Dass ich mich als Juristin mal so weit auf wirtschaftliches Terrain vorwagen würde, hätte ich mir früher überhaupt nicht vorstellen können.