Burkard Hillebrands im Interview
Gut forschen & gut reden

Professor Hillebrands, das IFW betreibt vor allem Grundlagenforschung. Derzeit laufen bei Ihnen Hunderte von Projekten, etwa zu Details aus der Quantenphysik, die kaum ein Laie verstehen dürfte. Trotzdem versuchen Sie, Ihre Forschung auch der breiteren Öffentlichkeit nahezubringen. Wie kann das gelingen?
Das gelingt, indem man einzelne Beispiele herausgreift, an denen man zeigt, wozu etwas gut sein kann. Ich rede nicht gern von Grundlagenforschung hier und angewandter Forschung dort. Das zementiert nur einen Gegensatz, den es in der Form gar nicht mehr gibt. Zumindest nicht bei uns am IFW. Wir machen Grundlagenforschung, die immer ein Auge auf mögliche Anwendungen hat. Und das können wir der Öffentlichkeit auch vermitteln. Zugegeben, manche Forschungsgebiete eignen sich dafür besser als andere. Etwa das Thema Thermoelektrik ...
... also Materialien, die Wärme in Strom umwandeln können.
Genau. Diese Materialien haben im Moment noch keinen besonders hohen Wirkungsgrad. Dennoch gibt es für sie schon heute viele Anwendungen – nämlich überall dort, wo Sie vor Ort Elektrizität erzeugen müssen, weil Sie keine Leitung legen können. Denken Sie an Sensoren, die der Sicherheit von Brücken dienen. Mit dieser Technik sind wir auch mittendrin in der Industrie 4.0, also bei dem, was die Privatwirtschaft interessiert.
Gehört es zu Ihren Zielen, das IFW stärker in die Medien zu bringen?
Ganz sicher.
Warum?
Ob ein einzelner Zeitungsartikel etwas bringt, kann man natürlich schwer sagen. Trotzdem muss man gut forschen – und gut darüber reden, um das Interesse an unserer Arbeit wachzuhalten. Es besteht immer die Gefahr, dass in der Diskussion zu kurz gedacht wird, nach dem Motto: Lass uns endlich das absolut energieeffiziente Wundermaterial entdecken. Aber so funktioniert Forschung nicht. Und genau das müssen wir vermitteln.
Worin liegt denn der gesellschaftliche Nutzen von Grundlagenforschung?
Wissen ist die Grundlage unseres Zusammenlebens, die Basis einer modernen Gesellschaft. Alle technologischen Entwicklungen beruhen auf Grundlagenforschung, aus ihr kommen die neuen, richtungsweisenden Ideen. Nehmen Sie die Teflon-Bratpfanne. Oder das GPS-Ortungssystem, das auf Einsteins Relativitätstheorie basiert. Man muss die Grundlagen erkennen, um die Welt besser zu verstehen – und findet dabei Anwendungen, an die vorher kein Mensch hat denken können. Unsere sehr ausdifferenzierte Wissensgenerierung ist ein großes Pfund. Aber wenn wir die Grundlagenforschung nicht auf höchstem Niveau pflegen, fehlt uns bald der Brennstoff für neue Technologien.
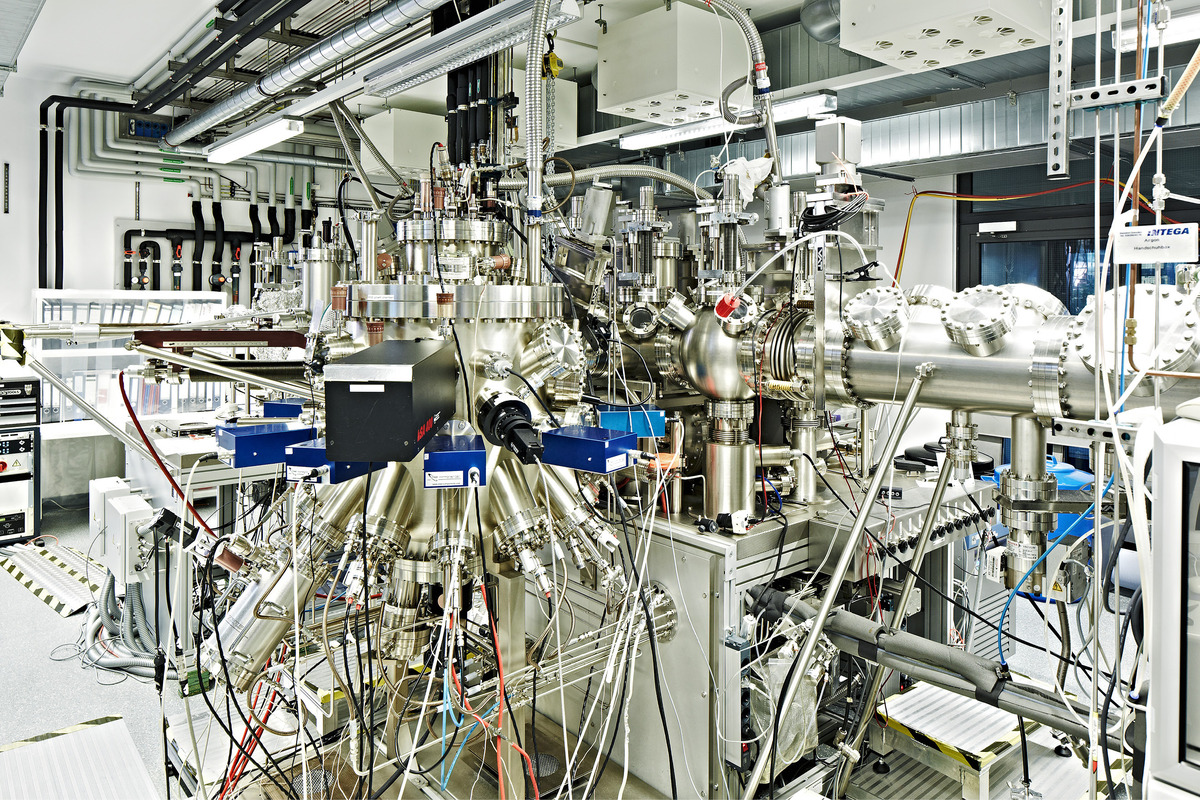
Wie vermitteln Sie das der Öffentlichkeit am besten?
Es passiert schon eine Menge. Nehmen Sie die Dresdner „Lange Nacht der Wissenschaften“: Da strömen Tausende Besucher aller Altersklassen durch die Labore und wollen alles wissen. An solchen Abenden haben wir auch die nötige Muße, den Leuten Antworten zu geben. In diesem Jahr stand das Thema Supraleitung im Fokus.
Ihre Modellbahn „SupraTrans“ sorgt immer wieder für staunende Besucher: Zwei Personen gleiten in einem Wagen über einem Gleis – und der Wagen schwebt.
Die gibt es schon seit fünf Jahren, deshalb haben wir diesmal andere Anwendungen in den Blick gerückt. Zum Beispiel haben wir mit der TU Dresden völlig neuartige Lager für Textilmaschinen entwickelt: Bei denen senkt bislang die Reibung zwischen dem rotierenden Metallring mit dem Faden und dem Läufer die Produktivität. Da bringen supraleitende Magnetlager enorm viel, denn die arbeiten reibungsfrei.
Ein anderer IFW-Hit war das „Lexus Hoverboard“. Die japanische Automarke hat mit Ihrer Hilfe eine Art fliegendes Skateboard gebaut, das vier Zentimeter über einem Gleis schwebte. Das sah schon ziemlich nach dem Skateboard aus der Zukunft aus, das Marty McFly, die Hauptfigur des Achtzigerjahre-Films „Zurück in die Zukunft“, benutzt hat. Der Lexus-Werbeclip war ein großer Erfolg, bei Youtube wurde er 14 Millionen Mal geklickt.
Ja, auch dieses Board hat enorm zur Sichtbarkeit des Hauses in der Öffentlichkeit beigetragen. Von solchen Aktionen brauchen wir noch mehr. Die sind für Anwender spannend und zugleich dankbare Themen für die Öffentlichkeit. Der Weg dahin führt allerdings über knallharte Quantenphysik. Und er ist sehr lang.
Was haben Sie in den kommenden Jahren vor?
Ich würde mir wünschen, dass unser Institut eine Kultur entwickelt, in der noch viel stärker an die Öffentlichkeitsarbeit gedacht wird. Dadurch sichern wir schließlich die Ressourcen für unsere Forschung.
Nur: Wie schafft man so einen Mentalitätswandel? Die Kollegen hier im Haus haben ja schon jetzt genug zu tun. Es ist meine Aufgabe, ihnen noch stärker klarzumachen, worin der Wert einer guten Öffentlichkeitsarbeit liegt. Die Öffentlichkeit ist schließlich kein Monolith, sondern eine Sammlung ganz unterschiedlicher Akteure: Die lokale Bevölkerung gehört natürlich dazu, aber auch das Land Sachsen. Das muss immer wieder gewonnen werden, denn von dort kommt ein Großteil unseres Geldes.

Was heißt das konkret?
Nun, Politiker entscheiden über das Geld, das wir bekommen, also müssen sie angesprochen werden. Dann haben wir noch den Bund und die Leibniz-Gemeinschaft. Auch dort muss man immer wieder klarmachen, welchen Stellenwert dieses Institut hat. Ein weiterer wichtiger Spieler ist die Industrie, der Mittelstand. Und auch die wissenschaftliche Gemeinschaft dürfen wir nicht vergessen, denn die Basis unseres Hauses ist das wissenschaftliche Renommee – wenn man das nicht hat, kann man alles andere vergessen.
Viel zu tun für eine Pressestelle.
Absolut. Wir unterhalten allein für die Vernetzung mit der Europäischen Union ein eigenes, kleines Referat. Ich möchte auf dem Laufenden sein, wann und wo Konsultationen in der EU stattfinden, die Themen unseres Hauses betreffen.
Sie haben dieses Referat, um die vielen Förderprogramme der EU im Blick zu haben?
Nicht nur. Natürlich ist es gut, die aktuellen Richtlinien zu kennen. Aber noch besser ist es, wenn man Einfluss auf die kommenden Richtlinien nehmen kann. Die entstehen ja aus Konsultationsprozessen – und die Politik holt sich ihren Input von Spezialisten: Was soll als Nächstes gefördert werden? Welche Schwerpunkte sollen wir setzen? Da ist es gut, mit am Tisch zu sitzen. Ein Haus wie das IFW sollte sich in angemessener Form daran beteiligen. Auch das ist eine Form der Öffentlichkeitsarbeit.
Öffentlichkeitsarbeit kann auch den wissenschaftlichen Nachwuchs im Auge haben. Wie schwer ist es für Sie, gute Leute zu bekommen?
Es läuft ganz gut. Wir haben am IFW sehr viele Doktor- und Masterarbeiten, etliche jüngere Post-Docs und auch sonstige Ausbildungsberufe. Viele gute Leute. Das hat mehrere Gründe: Dresden ist einerseits ein exzellenter Wissenschaftsstandort, bietet aber auch als Stadt eine Menge. Das lockt die Leute an.
Wir haben beispielsweise gerade ein Programm gestartet, mit dem wir neue Nachwuchsprojekte suchen. Junge Post- Docs können sich mit ihrem eigenen Forschungsprogramm bewerben, die Thematik ist relativ frei. Und wir sind erstaunt über die vielen sehr guten Bewerbungen aus aller Welt.
Welches Bild hatten Sie von der Stadt Dresden und dem Freistaat Sachsen, als Sie im Sommer 2016 am IFW begonnen haben?
Ich komme vom anderen Ende der Republik, dem äußersten Westen. Aber Sachsen genoss für mich schon immer einen exzellenten Ruf, insbesondere die Dresdener Region. Ich mag die überaus große Dichte und Leistungsfähigkeit der Forschungslandschaft, die sich um eine Exzellenz- Universität gruppiert – Dresden wird als Wissenschaftsstandort in einem Atemzug mit München oder Berlin genannt. Außerdem mag ich die Offenheit der Dresdner, das städtische internationale Flair und die Kulturszene, vor allem im Bereich Musik.
Dresden hat kein Image-Problem?
Von Phänomenen wie Pegida, die sehr unschön sind und viel Aufmerksamkeit von den Medien bekommen, darf man sich nicht irritieren lassen. Es gibt einzelne Wissenschaftler, die Dresden verlassen haben. Aber die Bewerberlage auf international ausgeschriebene Wissenschaftlerstellen ist bei uns nach wie vor sehr gut.
Das Renommee Ihres Instituts ist hoch, das kann man vom Ansehen der Stadt derzeit nicht behaupten. Knirscht es da in der Zusammenarbeit?
Nein. Die Stadt weiß, welche Schätze sie besitzt, und hat stets ein offenes Ohr für die Belange der Wissenschaft.
Wie sieht das konkret aus?
Zum Beispiel bringt sich die Stadt substanziell in die erwähnte Lange Nacht der Wissenschaften ein. Vor Kurzem hat sie den Platz an der Frauenkirche für eine Wissenschaftsausstellung zur Verfügung gestellt. Sie organisiert Gesprächsrunden, es gibt eine Vortragsreihe „Wissenschaft im Rathaus/Theater“ und vieles mehr. Dresden ist ein guter Partner.
Schwärmen Sie doch bitte auch mal, wenn es um die Zukunft Ihres Instituts geht: Was wird das nächste große Ding? Woran wird bei Ihnen zurzeit gearbeitet?
Wir beschäftigen uns mit einer Reihe spannender Projekte. Ein richtig heißes Thema der Materialphysik sind gerade topologische Isolatoren: Das Innere dieser Kristalle wirkt wie ein Isolator, es blockiert jeglichen Stromfluss, die Oberfläche dagegen leitet Strom – das Material kann also gleichzeitig als Isolator und elektrischer Leiter agieren.
Dann wollen wir in den kommenden Jahren einen sogenannten Quantenrepeater herstellen – der soll die Übermittlung von Quanteninformation über große Entfernungen ohne Datenverlust ermöglichen. Dabei stehen wir zurzeit in einem regelrechten Wettlauf mit anderen Einrichtungen – unser Vorteil ist jedoch, dass wir hier alle Kompetenzen unter einem Dach haben, von der theoretischen Physik über die Materialentwicklung bis hin zum Design der Bauelemente.
Ein drittes Beispiel: aufgerollte Nanomembranen. Unser „Spermbot“ besteht aus kleinen Spiralen, die mit einer magnetischen Schicht aus Nickel und Titan überzogen sind. Durch ein äußeres Magnetfeld kann er Spermien zur Eizelle bringen. Die Vision gibt es, auf dem Weg zur Anwendungsreife haben wir allerdings noch einige Probleme. Doch wenn das klappt, wird es ein wirklich großes Ding.
Name und Logo der „Leibniz- Gemeinschaft“ wurden 2002 aus Marketing-Gründen eingeführt. Darunter fallen knapp 90 Institute aus ganz Deutschland, die in so unterschiedlichen Feldern wie der Erwachsenenbildung, der Raumentwicklung, der Nutztierbiologie und der Marinen Tropenökologie forschen. Mit etwa 500 Mitarbeitern gehört das Dresdner Leibniz-Institut für Festkörperund Werkstoffforschung (IFW) zu den großen Häusern der Gemeinschaft. Es ist 1992 aus dem früheren Zentralinstitut für Festkörperphysik und Werkstofforschung der Akademie der Wissenschaften der DDR hervorgegangen, das zu DDR-Zeiten bereits international renommiert war.
Seit 1949 dürfen in Westdeutschland mehrere Bundesländer gemeinsam ein Forschungsinstitut finanzieren, wenn der Geldbedarf für ein einzelnes Land zu groß ist. Zwei Jahrzehnte später wurde der Artikel 91b ins Grundgesetz aufgenommen. Seitdem können Bund und Länder „in Fällen überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre zusammenwirken“. Nach der deutschen Wiedervereinigung wurden viele ostdeutsche Institute in die sogenannte Blaue Liste der bundesweit geförderten Einrichtungen aufgenommen. War es 1989 – noch vor der Wende – ein loser Zusammenschluss von 47 Instituten, stieg ihre Zahl in den folgenden drei Jahren auf 81. Unter den Neuzugängen war auch das IFW. 2016 hatte das Dresdner Institut einen Etat von 43 Millionen Euro: Je 16,5 Millionen kommen vom Bund und den Ländern (davon 12,6 Millionen vom Freistaat Sachsen), etwa 10 Millionen aus Drittmitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft e.V. und der EU sowie der Industrie.
Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.