Der Patient
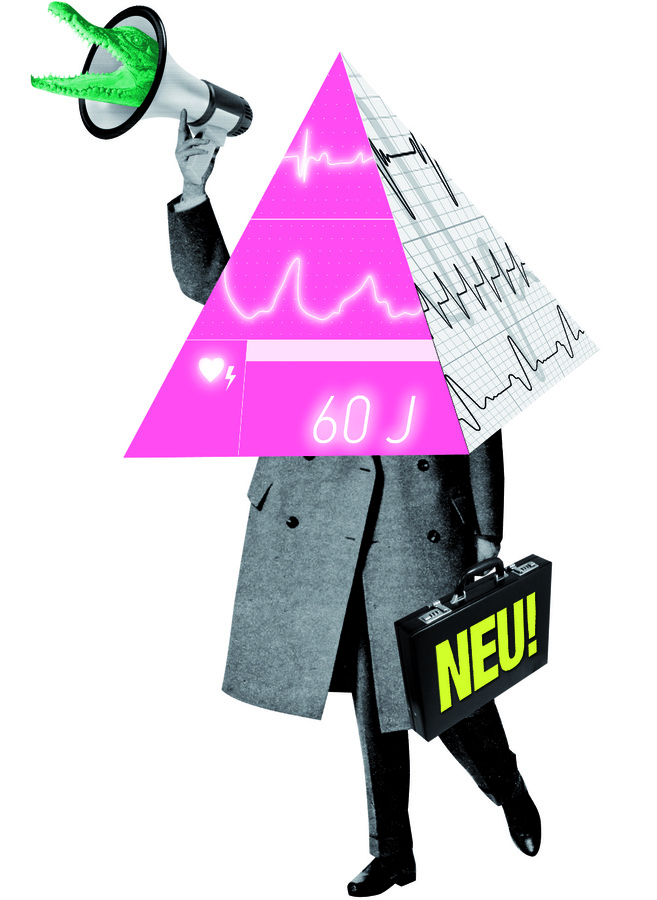
„Ich bin seit über 20 Jahren HIV-positiv, und es sind Medikamente, die mich seitdem am Leben halten. Die mich aber nicht nur überleben lassen, sondern mir auch ein weitgehend normales Leben ermöglichen. Medikamente haben bei Aids das große Sterben beendet, auch bei Freunden und Bekannten, und dank dieser Mittel bin ich nicht mehr infektiös, also auch keine Gefahr für andere Menschen.
Ich will, dass gute Medikamente im Markt bleiben und die Entwicklung weiter vorangeht, damit sich Wirksamkeit und Verträglichkeit erhöhen und eine HIV-Infektion vielleicht wirklich einmal geheilt werden kann. Aber so klar diese Position ist, ergeben sich aus ihr auch Konflikte – mit der Pharmaindustrie, den Ärz ten, der Politik, den Zulassungsbehörden.
Wenn es um die Versorgung geht, bin ich mit der Pharmaindustrie sehr zufrieden. Die HIV-Therapie ist eine Erfolgsgeschichte – selten wurden so schnell so gute Medikamente entwickelt, die Grundlagenforschung ist hervorragend. Und auch wenn jetzt langsam Medikamente auftauchen, über deren Sinn man sich streiten kann, gibt es kein großes Problem mit Scheininnovationen – was freilich auch daran liegt, dass der Markt noch so jung ist.
Was mich allerdings stört, ist das überzogene Marketing. Es gibt Hersteller, die vermarkten ihre Medikamente über die Rocklänge ihrer Vertreterinnen, andere machen Deals mit Ärzten. Eine Rolex als Dankeschön für Verschreibungen – so etwas ist zwar rückläufig, kommt aber immer noch vor. Ich habe es auch selbst erlebt, dass sich ein Sponsor zurückzog, weil sein Name in einer Publikation nicht genannt wurde. Und all diese glücklichen, muskulösen Menschen in der Werbung – das ist völlig unrealistisch und birgt – gekoppelt mit oft verzögerten Informationen über Nebenwirkungen – die Gefahr, dass selbst ein gut informierter Schwerpunktarzt dem Marketing erliegt und HIV-Patienten nicht das für sie beste Medikament bekommen.
Grundsätzlich geben Unternehmen viel zu viel Geld für Marketing aus. Das könnten sie sich sparen und stattdessen die Medikamente günstiger anbieten. Spielraum dafür gäbe es durchaus – jenseits der Proteasehemmer sind HIV-Medikamente in der Herstellung oft Cent-Artikel, die für einen Bruchteil der jetzigen Preise angeboten werden könnten. Aber das macht natürlich keiner, denn sind die Preise erst einmal hoch, werden sie selten gesenkt, zumal sich die Hersteller bei der Preisfindung vor allem an den Mitbewerbern orientieren.
Jeder nimmt, was er kriegen kann, das ist auf dem Pharmamarkt wie in anderen Branchen. Ein besonderer ethischer Anspruch ist Unsinn, es geht ums Geschäft, da ist die Politik gefragt. Aber auch auf deren Seite läuft meiner Meinung nach nicht alles optimal. Die Regulierungen auf dem Pharmamarkt ähneln doch sehr der Flickschusterei.
Die neuen Regeln des AMNOG bilden keine Ausnahme. Die frühe Nutzenbewertung halte ich für ein verkapptes Instrument zur Preisreduktion. Warum ist man nicht ehrlich und legt die Preise einfach gesetzlich fest? Und wie soll man einen ,Zusatznutzen‘ definieren? Selbst wenn das Urteil negativ ausfällt, kann ein Medikament bestimmten Patienten nützen. Und wie soll man über eine Arznei urteilen, die etwa bei HIV die Viruslast besonders effektiv senkt, dafür aber mehr Nebenwirkungen hervorruft? Nutzen ist eine sehr individuelle Sache, und man darf wirksame Medikamente nicht wegen irgendwelcher exotischen Nebenwirkungen abstrafen. Viele Leute sind darauf angewiesen.
Natürlich tragen auch Patienten Verantwortung für das Gesundheitssystem – sie können mit den Ressourcen sorgsam umgehen. Irgendwann wird es auf dem deutschen Markt auch Generika-Präparate gegen HIV geben. In der eigentlichen Therapie aber gibt es zu Medikamenten keine Alternative – wer sie nicht nimmt, stirbt. Einfach mal verzichten – diese Forderung wäre vermessen.
Doch selbst HIV-Patienten können etwas tun, etwa beim Nebenwirkungsmanagement oder der Psychohygiene. Ich sage immer: Wer Depressionen hat, soll erst mal Sport machen, bevor er sich Pillen verschreiben lässt. Und wenn ich einmal gut eingestellt bin, muss ich auch nicht alle drei Monate zur Neu-Diagnose zum Arzt rennen, um alle möglichen Laborwerte bestimmen zu lassen.
Bei der Verantwortung der Patienten liegt noch einiges im Argen, was sicher an der mangelnden Aufklärung liegt. Viele folgen einer Maschinen-Ideologie, nach der man den Körper mit Medikamenten eben repariert. Ein Fach ,Gesundheitskunde‘ in der Schule wäre nicht schlecht, und bei Arzneien sollten mehr Informationen auch den Patienten direkt zugänglich sein, nicht nur den Ärzten. Wobei das eigentliche Problem nicht fehlende Informationen sind, sondern ihre Bewertung. Aber da habe ich auch keine perfekte Lösung.“
Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.