Rheuma in Großbritannien
Hilfe von allen Seiten
So geht die Welt mit Rheuma um.
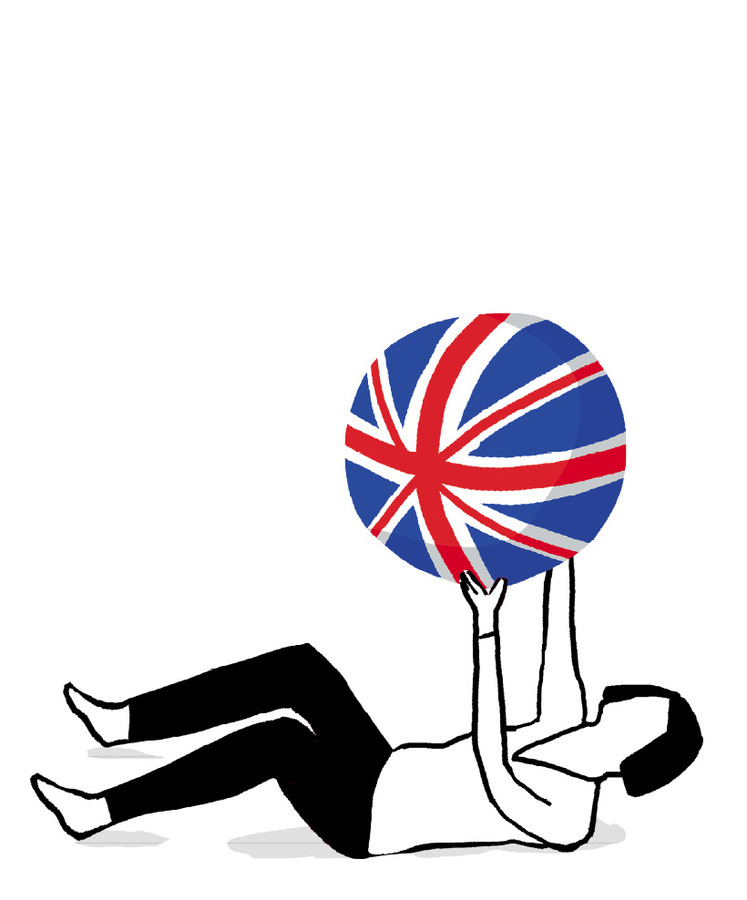
Im britischen Gesundheitssystem wird man als Patient am besten versorgt, wenn man genau weiß, was man braucht, und es mit Nachdruck einfordert“, sagt Sarah Wallace. Bei der 48-jährigen Engländerin wurde vor 20 Jahren erstmals rheumatoide Arthritis diagnos-tiziert. Sie stand kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung zur Buchhalterin und arbeitete bereits für ein großes britisches Reiseunternehmen.
Ihr Arbeitgeber sei sehr verständnisvoll gewesen, sagt Wallace: „Er stellte einen Online-Fragebogen zur Verfügung, mit dem ermittelt werden sollte, wie meine Arbeit den Symptomen angepasst werden konnte.“ Weil sie damals selbst noch keine Erfahrung mit der Krankheit hatte, zog das Unternehmen außerdem einen arbeitsmedizinischen Berater (occupational health advisor) hinzu. Seinen Ratschlägen folgend, wurden kleine, entscheidende Arbeitserleichterungen geschaffen, beispielsweise durch gelgefüllte Handgelenkstützen am Computer.
Die Behandlung chronischer Beschwerden obliegt im Vereinigten Königreich dem staatlichen, steuerfinanzierten Gesundheitsdienst National Health Service (NHS). Das schließt die Beobachtung des Krankheitsverlaufs durch den Hausarzt und Behandlungen durch Rheu- matologen ein. Die erfolgen in der Regel im Krankenhaus, weil es in Großbritannien so gut wie keine niedergelassenen Fachärzte gibt.
Individuelle Lösungen
Die Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit, inklusive präventiver Maßnahmen wie Anti-Rauch-Kampagnen, kommt seit Kurzem nicht mehr direkt vom NHS: 2013 übertrug die britische Regierung die Verantwortung dafür samt der Verwaltung des jährlichen Budgets von umgerechnet 3,8 Milliarden Euro den Kommunen. Sarah Wallace beispielsweise erhält für Transport und Pflege eine wöchentliche staatliche Behindertenzulage von umgerechnet 27 Euro. Die wird momentan unabhängig von der finanziellen Lage des Empfängers gewährt. Aber wer weiß, wie lange noch?
Laut einer Studie des britischen Gesundheitsministeriums stellt für mehr als die Hälfte aller chronisch Erkrankten ihre gesundheitliche Verfassung ein Hindernis für die Art und Menge von Arbeit dar, die sie verrichten können. Arbeitgeber gehen damit unterschiedlich um.
Große Firmen haben oft eigene arbeitsmedizinische Berater, andere holen sich über Einrichtungen wie die staat-liche Health and Safety Executive oder das College of Occupational Therapists Rat. Das ebenfalls staatlich finanzierte „Access to Work Programme“ bezahlt für arbeitsfähige chronisch Kranke in vielen Fällen die Anpassung der Arbeitsumgebung und weitere unterstützende Maß- nahmen wie etwa die psychische und physiotherapeutische Betreuung. Eine wichtige beratende Rolle spielen auch fachkompetente gemeinnützige Organisationen wie die unabhängige Gesundheitsstiftung King’s Fund und, im Falle von Sarah Wallace, die National Rheumatoid Arthritis Society.
Wallace’ Erfahrungen am Arbeitsplatz waren fast durchgehend positiv. Nur 2011, als sie bei einem Müllbeseitigungsunternehmen angestellt war, fühlte sie sich aufgrund ihrer Erkrankung gemobbt. „Das war aber kein Problem mit der Firma, sondern mit einer Person ohne Führungsqualitäten“, sagt Wallace. Ihre Chefin bestand darauf, dass sie 70 Stunden in der Woche arbeitete, und erlaubte ihr nicht, ihre Krankenhaustermine wahrzunehmen, sagt Wallace. Das widersprach ganz klar den Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes für Behinderte, die auch für Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen wie Rheuma gelten.
Sarah Wallace verließ das Unternehmen, das ihr letztlich eine hohe Abfindungssumme zahlte. Ein halbes Jahr später trat sie ihren derzeitigen Job beim Justizministerium an, für das sie nun seit vier Jahren in der Gefängnisverwaltung arbeitet. Ihre bislang erste Anstellung im öffentlichen Dienst bringt manchen Vorteil: So kümmern sich dieselben arbeitsmedizinischen Berater, die für die Fitness der Gefangenen sorgen, auch um die Gesundheit der Angestellten.
Einmal im Jahr findet am Arbeitsplatz ein Gesundheits-Check-up statt, einschließlich eines Tests ihrer psychischen Belastbarkeit. An Tagen mit Arztterminen muss Sarah Wallace nicht die 65 Kilometer aus Aylesbury nach London pendeln – ihr steht dann ein Büro an ihrem Wohnort zur Verfügung. „Und wenn ich dreimal in der Woche ins Fitness-Studio gehe, kann ich ein bisschen später zum Dienst kommen, solange ich die Zeit wieder aufhole“, sagt sie. „Ich musste nur nachdrücklich genug erklären, wie wichtig dieses Training für mein Wohlbefinden ist.“
Der öffentliche Dienst sei dennoch nicht in jedem Fall ein besserer Arbeitgeber für chronisch Kranke, meint Wallace. Private Firmen, die sich gewissenhaft auf die Bedürfnisse der Angestellten einstellten, könnten oft rascher und auch großzügiger reagieren. So sei ihr der Vorgänger der Vorgesetzten, deretwegen sie ihren alten Job verließ, besonders entgegengekommen: „Ich hatte ein Dienstauto, dessen Kupplung mir beim Schalten Schmerzen im Knie verursachte“, erzählt Sarah Wallace. „Das erklärte ich ihm, und kurz darauf bekam ich einen Wagen mit Automatikgetriebe, obwohl ich den anderen erst drei Monate gefahren hatte. So etwas könnte mein jetziger Arbeitgeber gegenüber dem Steuerzahler wohl kaum verantworten.“
Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.