Ungleichgewicht, das allen schadet

WER IST SCHULD AN ARMUT UND MANGELNDER GERECHTIGKEIT DIESER WELT?
Herr Sachs, wieso ist die Welt so ungerecht?
Solange einseitige Abhängigkeiten vorherrschten, war Gerechtigkeit eine Sache für Idealisten. Die mächtigen Gesellschaften mussten keine negativen Folgen ihres Verhaltens befürchten. Das hat sich in der Globalisierung verändert, denn sie brachte wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den bisherigen Gewinnern und Verlierern hervor: Chinas Boom treibt die Preise für Benzin, Getreide und Milch; die kleinbauernfeindliche Politik von Welthandelsorganisation (WTO) und Weltbank leistet der Migration aus Afrika nach Europa Vorschub. So wird Verarmung in der Ferne zu einem politischen Faktor für den Wohlstand hierzulande. Knappe Ressourcen und Umweltgüter werden in diesem Jahrhundert zahllose große und kleine Konflikte auslösen. Wer das vermeiden will, muss eine neue Politik der „Gerechtigkeit für Realisten“ verfolgen.
Aber die Armut ist seit 1990 global zurückgegangen. Trotz der weltweit wachsenden Bevölkerung leben heute weniger Menschen mit ein bis zwei Dollar am Existenzminimum. Das ist doch ein Ergebnis der klassischen Wachstumsstrategie.
Ein halbes Jahrhundert lang galt die Metapher, nach der das Wirtschaftswachstum wie steigendes Hochwasser alle Schiffe, ganz egal, ob groß oder klein, weiter nach oben hebt. Wenn aber das Hochwasser Dämme zerstört und über die Ufer tritt, dann haben wir ein Problem.
Bisher gibt es kein Wachstum ohne den gleichzeitigen Verschleiß der Natur. Die wirtschaftliche Entwicklung Chinas, Indiens und anderer bevölkerungsreicher Länder schreitet rasant voran. Gewiss, das drängt die Geldarmut zurück, aber die Tragik liegt darin, dass der Auszug aus Armut und Ohnmacht mit dem Einzug in die ökologische Raubökonomie erkauft wird. Dagegen werden nachhaltige Technologien und Konsumstile viel zu langsam verbreitet. Das Streben der Weltgesellschaft nach Wohlstand wird an den Grenzen scheitern, die uns die Umwelt setzt.
Welche Grenzen sind das genau?
Bereits seit Mitte der siebziger Jahre hat der Mensch die Begrenzungen des Umweltraums überschritten. Jedes Jahr entnehmen wir der Natur 20 Prozent mehr, als sie regenerieren kann. Am schärfsten spürbar ist für uns das heraufziehende Ende des Ölzeitalters. Doch auch Süßwasservorkommen, die sich im Laufe von Jahrtausenden gebildet haben, werden knapp. In den Vereinigten Staaten wird beispielsweise das unterirdische Ogallala-Aquifer für die Bewässerung von Getreidefeldern so über die Maßen genutzt, dass in den nächsten 20 Jahren schätzungsweise 40 Prozent der damit bislang bewässerten landwirtschaftlichen Flächen brachliegen könnten.
Auch die Waldfläche geht drastisch zurück. Kahlschlag und Brandrodung haben große Teile des Amazonas-Urwaldes zerstört und Dürreperioden ausgelöst. Nur noch ein Viertel der weltweiten Fischbestände ist ungefährdet. Biologische Vielfalt aber ist eine Grundvoraussetzung für die Stabilität der Ökosysteme, von denen auch der Mensch abhängt. Die Anzeichen einer chronischen Überdehnung sind unübersehbar: steigende Benzinpreise, Wasserknappheit, Erosion der Agrarflächen, leere Fischnetze – das sind Erscheinungsformen der Grenzen.
Gibt es eine Rangordnung der Weltprobleme?
Der Klimawandel ist sicher das größte Umweltrisiko, da er die Funktion sämtlicher Ökosysteme stört, die alle miteinander verknüpft sind. Eine einzelne Veränderung wie etwa ein Temperaturanstieg hätte nur dann geringe Auswirkungen, wenn nur wenige Ökosysteme betroffen wären. Das Gegenteil aber ist der Fall.
Droht uns also ein Dominoeffekt?
Genau das, und zwar mit dramatischen Folgen. Erwärmt sich die Erde weiter, werden die Eisdecken Grönlands und der Arktis bedrohlich schmelzen. Schon bei zwei bis drei Grad Erwärmung – und zwei Grad können schon kaum mehr ausgeschlossen werden – steigt der Meeresspiegel um einige Dutzend Zentimeter, und mehr als eine Million Menschen in tief liegenden Küstengebieten werden ihrer Heimat beraubt. Die Ernteerträge könnten weiter einbrechen, Krankheiten wie Malaria auf bislang nicht betroffene Regionen übergreifen. Viele Tierarten, die nur in bestimmten Klimazonen überleben, werden aussterben. Halbtrockene Landstriche verwandeln sich in Wüsten und gehen damit für die Landwirtschaft und als Lebensraum verloren.
Es wird mehr Regen und heftigere Stürme geben. In vielen Regionen wird es durch die Gletscherschmelze zu massiven Überschwemmungen kommen, doch sobald die Gletscher vollkommen verschwunden sind, wird extremer Wassermangel herrschen. So hängt etwa der größte Teil der Nahrungsmittelproduktion in Indien und China von Flüssen ab, die der Himalaja speist. Das ist ein ernsthafter Angriff auf die Überlebensfähigkeit von Hunderten Millionen Menschen, mit unmittelbaren Folgen für die Ernährungssituation in der gesamten Welt.
Warum ignorieren wir diese Gefahren noch immer?
Die meisten Menschen sind sich der langfristigen Konsequenzen ihres Handelns nicht bewusst. Das hat zwei Gründe: Viele Folgen der Aktivitäten von heute sind erst morgen oder übermorgen spürbar. Daneben gibt es eine räumliche Trennung: Nicht nur Ressourcen sind zwischen Norden und Süden ungleich verteilt, sondern auch die Folgeschäden des Ressourcenverbrauchs. Die bitteren Auswirkungen des Klimawandels treffen schon heute die Länder und Menschen, die am wenigsten zu ihm beitragen. Sie werden die Folgen auch in Zukunft am heftigsten spüren: die großen Deltagebiete in China, Vietnam, Nigeria und besonders in Bangladesch, kleine Inselstaaten in der Südsee, trockene und halbtrockene Gebiete quer über den Globus.
Im Gegensatz dazu profitiert die Landwirtschaft in vielen Industrieländern momentan sogar von einer Erwärmung. Oder die Folgeschäden lassen sich leichter wegstecken: Hier experimentieren Winzer einfach mit neuen Rebsorten, die auch unter wärmeren Bedingungen gedeihen. Dieser Luxus fehlt in Ländern, in denen die Veränderungen schneller eintreten und besonders jene treffen, die schon am Existenzminimum leben. Armut ist dort ein Kollateralschaden der Reichtumserzeugung.
Es sieht nicht so aus, als würde sich all das in absehbarer Zeit ändern. Unser Ressourcenhunger zur Befeuerung des Wohlstands scheint jedenfalls unstillbar.
Und er verschlimmert die ohnehin dramatische Situation. Nehmen wir das Öl, seit Langem ein zentraler Faktor geopolitischer Strategien. Die USA, Europa und das aufstrebende Asien streiten um Ölquellen und treiben die Preise nach oben. Darunter leiden besonders die armen Länder. Ihre Staatsverschuldung wird wachsen, das Wirtschaftswachstum wird geschwächt, Düngemittel und Transporte werden teurer. Schon heute fehlt in zahlreichen Staaten Afrikas das Benzin: Nutzfahrzeuge bleiben einfach liegen und stehen in der Landschaft herum.
Derzeit verändert sich vor allem das Preisgefüge des Alltagsbedarfs. Wir können das leichter wegstecken als jene, die heute schon knapsen müssen. Weit vor den ökologischen werden die sozialen Grenzen der Nutzung fossiler Energieträger sichtbar. Die Endlichkeit des Öls wird zum Destabilisierungsfaktor, lange bevor das letzte Barrel aus der Erde gepumpt ist.
Auch landwirtschaftliche Fläche ist eine global begehrte Ressource geworden.
Die Industrieländer haben daran entscheidenden Anteil. Sie machen den Ländern im Süden Agrarfläche streitig, weil dort Güter für den Export in die Industrienationen angebaut werden. Allein die Europäische Union (EU-15) nimmt durch den Import von Agrarrohstoffen und -produkten eine Fläche von 43 Millionen Hektar in den Herkunftsländern in Anspruch, was mehr als einem Fünftel deren Territoriums entspricht.
Wo Kleinbauern früher Reis und Mais für den Eigenbedarf und den heimischen Markt anbauten, pflanzen private Agrarproduzenten heute Produkte mit größeren Margen an, etwa exotische Früchte oder Schnittblumen für die Konsumenten in Übersee. Viele Länder des Südens können ihre Binnennachfrage nach Grundnahrungsmitteln deshalb nicht mehr durch die eigene Produktion decken und werden zunehmend von Nahrungsimporten abhängig. Wie gefährlich das ist, zeigt der rasante Anstieg der Lebensmittelpreise, in dessen Folge große Teile der heimischen Bevölkerung verarmen. Dies führt zu Landflucht, zu Wachstum von Slums und zunehmender Gewalt. Kurzum: Es kommt zu einer gefährlichen Polarisierung von Arm und Reich.
Die Weltbank befürchtet in mindestens 33 Ländern der Erde Hungersnöte. Warum spezialisieren sich diese Nationen auf Exportgüter, wenn ihnen die eigene Unterversorgung droht?
Was sollen sie denn tun? Viele Entwicklungsländer sind gezwungen, Auslandsschulden abzutragen. Zur Schuldentilgung müssen sie Devisen erwerben, also am Welthandel teilhaben. Das geht aber nur, wenn sie Güter für den Export produzieren. Weltbank und Internationaler Weltwährungsfonds (IWF) haben in den vergangenen Jahrzehnten genau darauf gedrängt. Die internationalen Finanzinstitutionen sind daran interessiert, die Währungen von Entwicklungsländern stabil zu halten, um den globalen Geldkreislauf nicht zu stören. Dafür ist Schuldenabbau unerlässlich. Solange die Nationen aber billige Rohstoffe ausführen und teure Industriegüter einführen, haben sie Mühe, Einnahmen für die eigene Entwicklung zu erwirtschaften.
Zudem wächst in den betroffenen Entwicklungsländern die Zahl der Profiteure dieser Exportorientierung. Der Ressourcenkonflikt lässt sich immer weniger trennscharf als Kontroverse zwischen Nord und Süd beschreiben.
Es kommt mehr Geld in Umlauf, und ein kleiner Teil der Bevölkerung steigert seinen Reichtum. Die Ungleichheit im Weltmaßstab setzt sich in der Ungleichheit innerhalb einzelner Länder fort. So ist der Streit um Wasser in vielen Entwicklungsländern häufig eine Auseinandersetzung zwischen den regionalen Eliten und der lokalen Bevölkerung. Durch Staudämme, Kanäle oder Pipelines wird Wasser aus den Landgebieten in die kaufkräftigen Zentren umgeleitet.
Den Regierungen, die diese Investitionen vorantreiben, geht es um Prestigeprojekte, die Förderung der urbanen Mittel- und Oberklasse und ein höheres Wirtschaftswachstum. Opfer ist die arme Landbevölkerung, die aus ihrer Heimat vertrieben wird. Obwohl solche Infrastruktur-Investitionen als Entwicklungsprojekte angekündigt werden, führen sie häufig zu einer Verschlechterung der Lebenssituation der lokalen Bevölkerung.
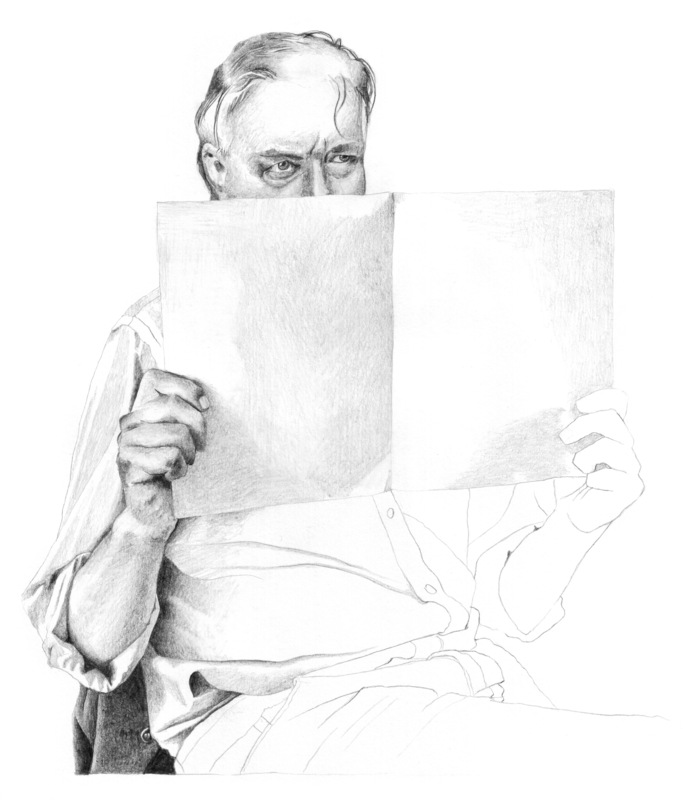
Der Entwicklung steht ein Machtgefälle gegenüber.
Wer die Regeln diktieren kann, hat Macht – und wer Macht hat, diktiert die Regeln. Nach diesem politischen Regelkreis sind vielfach auch die internationalen wirtschaftlichen Einrichtungen gebaut: die Weltbank, der IWF und vor allem die WTO, die weitgehend den Ordnungsrahmen der globalen Ökonomie festlegt.
Wollen Sie sagen, die Annahme der WTO, dass der Freihandel letztlich allen Handelspartnern gleichermaßen diene, sei falsch?
Die Freihandelsphilosophie ist eine Utopie. Sie hält der Empirie nicht stand. Bei Boxkämpfen lässt man auch nicht das Leichtgewicht gegen das Schwergewicht kämpfen, es gibt Wettkämpfe zwischen jeweils gleich Starken. Die WTO handelt nach einer Doppelmoral: Einerseits wird den Entwicklungsländern heute der Freihandel aufgedrückt, ohne ihnen den Protektionismus als Schonfrist zu gewähren, den die Industrieländer in ihrer Frühphase pflegten. Andererseits verordnet der Norden dem Süden offene Märkte. Selbst ist er aber weit davon entfernt, seine eigenen Märkte zu öffnen. Stattdessen werden südliche Märkte zunehmend von Produkten aus dem Norden überschwemmt, noch dazu mit Preisen, die durch Subventionen verbilligt sind. Die eigene Landwirtschaft wird in den OECD-Staaten mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar jährlich unterstützt – das ist übrigens das Sechsfache der offiziellen staatlichen Entwicklungshilfe.
Die Erkenntnis der Doppelmoral des Freihandels ist nicht neu.
Aber sie wird immer wieder verdrängt. Politische Schritte, die dem Problemdruck angemessen wären, bleiben aus. Stattdessen bahnt sich die Wirtschaftsmacht neue Wege, etwa durch völkerrechtliche Abkommen.
Im Moment wird zum Beispiel um die internationale Rechtsgrundlage für Patente auf genetische Codes von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen gestritten. Internationale Biotechnikfirmen suchen in Entwicklungsländern mit hoher Artenvielfalt nach Genmaterial, das ihnen bei der Verbesserung von Produkten der Pharma-, Kosmetik- oder Pflanzenschutzmittelindustrie hilft. Gelingt es ihnen, Patente auf die Eigenschaften der Stoffe anzumelden, können sie den Marktpreis nach Belieben bestimmen.
Unabhängig vom Preis: Die Welt braucht Forschung, Patente und Fortschritt.
Natürlich, aber jetzt stellt sich die Frage, wem biologische Ressourcen eigentlich gehören. Wenn ein Konzern einen Wirkstoff entdeckt, zum Beispiel in einem Baum, tauchen ganz neue Fragen auf: Gehört der Stoff dem Entdecker? Hat nicht eher die traditionelle Gemeinschaft der Bauern, die den Baum vielleicht über Generationen hinweg erhalten, gekreuzt und gezüchtet hat und heute davon lebt, ein Recht darauf? Warum sollte der Wirkstoff daraus zu einem Patent führen, an dem ein bestimmter Konzern verdient? Müssen mögliche Gewinne nicht zumindest geteilt werden? Wenn ja, mit wem? Mit der Regierung des Landes, aus dem der Wirkstoff kommt? Mit der traditionellen Gemeinschaft? Diese Fragen sind bis heute unbeantwortet.
Klar ist nur eines: Die Waffen in diesem Streit sind ungleich verteilt. Den ärmeren und kleineren Staaten stehen weniger Finanzmittel, Personal und politischer Einfluss zur Verfügung, um auf gleicher Höhe mit den reichen Staaten über Regeln zu verhandeln, die alle zufriedenstellen. Im Extremfall müssten Bauern, die bislang unentgeltlich Samen tauschen oder Schösslinge sammeln, nun Lizenzgebühren für die Nutzung der Natur bezahlen. Für manche bedeutet das eine Bedrohung ihrer Existenz und daher einen Eingriff in ihre Menschenrechte.
Ist diese Klage gegen die Verletzung von Menschenrechten nicht ein bisschen zu hoch gegriffen, wenn man über Patentschutz pflanzlicher Wirkstoffe spricht?
Überhaupt nicht. Existenzrechte umfassen den elementarsten Teil der Menschenrechte, nämlich alles, was Menschen zur Entfaltung als Lebewesen brauchen: gesunde Luft und genießbares Wasser, grundlegende Gesundheitsversorgung, angemessene Nahrung, Bekleidung und Unterkunft – und das Recht auf soziale Teilnahme und Handlungsfreiheit. Zur Sicherung dieser Existenzrechte kommt den Naturräumen ein hoher Stellenwert zu. Niemand ist stärker auf intakte Ökosysteme angewiesen als jenes Drittel der Weltbevölkerung, das für Nahrung, Kleidung, Behausung, Medizin und Kultur direkt vom unentgeltlichen Zugang zu natürlichen Ressourcen abhängt. Die Zerstörung der Naturräume untergräbt die Existenzrechte dieser Menschen. Das gilt im Fall von Biopatenten genauso wie für Versorgungsengpässe aufgrund einer exportorientierten Landwirtschaft.
Fortschritt hat seinen Preis, halten die Verfechter freier Märkte dagegen und verweisen auf die Möglichkeiten in der Zukunft. Zudem haben sie die allgemeine Steigerung des Wohlstands im Auge und nicht das Schicksal von Idividuen, die sich dabei möglicherweise Nachteile einhandeln.
Dabei kommt es auf die Gerechtigkeitsperspektive an. Menschenrechte sind Rechte konkreter Personen oder Gruppen. Menschenrechte sind absolut, sie können nicht mit einem größeren gesamtgesellschaftlichen Nutzen, jetzt oder in der Zukunft, verrechnet werden. Selbst wenn es ökonomisch mehr globalen Wohlstand erbrächte, wäre es ein Unrecht, die Malediven und ihre Bewohner dem Klimawandel zu opfern und untergehen zu lassen. Wirtschaftswissenschaftler ignorieren, dass einzelne Bevölkerungsgruppen oder Regionen Kosten zahlen müssen, die nicht zu rechtfertigen sind. Das widerspricht ethischen Maßstäben.
Was können die Starken tun, damit die Welt fairer wird?
Jahrzehntelang wurden Initiativen im Namen größerer Gerechtigkeit gestartet, wie etwa Armutsbekämpfung, Aids-Hilfe oder die Vergabe von Mikrokrediten. Dabei sollten sich immer nur die Armen und die Strukturen in den schwächeren Ländern ändern; selten wurde gefragt, ob sich nicht auch die Reichen verändern müssen.
Angesichts des massiven Ressourcenverbrauchs des Nordens und des voranschreitenden Klimawandels können wir dieser Frage aber nicht länger ausweichen. Historisch gesehen, geraten wir in eine Nullsummen-Situation: Wenn einer mehr haben soll, muss ein anderer weniger haben. Erst wenn die wohlhabenden Ökonomien ihre Produktions- und Konsummuster so umstellen, dass sie deutlich weniger natürliche Ressourcen verbrauchen, wird die Basis für eine menschenrechtsfähige Weltwirtschaft geschaffen.
Wir haben vom bisherigen System gut profitiert. Was kann den Anlass liefern, dass wir uns freiwillig einschränken?
Momentan treffen zwei Entwicklungslinien aufeinander. Zum einen gibt es Menschen, die nicht auf Kosten anderer leben wollen; gleichzeitig sehen sie einen Gewinn darin, Wohlstand, Produktion und Konsum neu zu definieren. Sie entwickeln Alternativen. In der Zivilgesellschaft, in Unternehmen und in der Verwaltung entstehen Parallelmärkte und Laboratorien. Es wächst etwas im Schoße des Alten.
Zum anderen gibt es externe Krisen: Katastrophen, Preissteigerungen, plötzliche Ereignisse, die bisherige Gewissheiten ins Schwanken bringen. Wenn beides zusammenkommt, findet Fortschritt statt. Optionen, die mitunter Jahrzehnte am Rande standen, werden plötzlich zu Lösungsmöglichkeiten.
Sehen Sie schon Beispiele für solche Prozesse?
Ohne die Freaks, die bereits vor 30 Jahren Windräder gebastelt haben, hätten wir heute keine florierende Windkraftindustrie. Und hätte es vor Jahrzehnten nicht schon Idealisten gegeben, die am Rande der Gesellschaft Biolandbau und Naturkostläden aufgebaut haben, gäbe es heute keine ökologische Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung.
Kann privates Engagement die Welt retten?
Es ist gut und wichtig, dass Bürger, Nichtregierungsorganisationen oder Stiftungen wie die von Bill Gates sich engagieren. Sie können die Rolle der Politik und internationaler Institutionen aber nur ergänzen, nie ersetzen. Wir brauchen vor allem andere Regeln für den Handel – Regeln, in denen die Menschenwürde und die Unversehrtheit der Biosphäre berücksichtigt werden. Es ist Ausdruck struktureller Verantwortungslosigkeit, wenn die WTO ihre Zuständigkeit allein auf Handelsfragen begrenzt und nationale Regierungen auffordert, sich um soziale und ökologische Themen zu kümmern, während sie gleichzeitig durch ihre Deregulierungspolitik deren Autorität immer mehr einschränkt. Multilaterale Handelsabkommen sind unverzichtbar, aber sie müssen auf einen politischen Ausgleich zwischen unterschiedlich gelagerten Volkswirtschaften hinarbeiten.
Was muss sich konkret ändern, damit der Zugang zu Naturressourcen so gestaltet wird, dass elementare Existenzrechte gesichert sind?
Handel durch Interessenabgleich statt Handel durch Regelfreiheit könnte die Devise sein. Es gilt, endlich die himmelweiten Unterschiede in den Ausgangspositionen und Fähigkeiten der Spieler zu berücksichtigen.
Aber das ist in der WTO doch schon möglich. Mit einer differenzierten Vorzugsbehandlung können Industrieländer Produkten aus Entwicklungsländern den Zugang zu ihren Märkten erleichtern. Südländer dürfen umgekehrt ausgewählte Importe ungleich behandeln.
Bislang bewegen sich diese Maßnahmen auf bescheidenem Niveau. Und sie reichen nicht aus. Nachdem die nationale Politik jahrzehntelang Kompetenzen abgegeben hat, müssen Regierungen wieder das Recht bekommen, Handelsströme zu beeinflussen – nicht als Ausnahme, sondern als Normalfall. Für die meisten Menschen in Entwicklungsländern ist Landwirtschaft die Haupteinkommensquelle. Daher brauchen Regierungen im Rahmen internationaler Handelsregeln neuen Spielraum, um ihre Binnenmärkte durch gezielte Politik aus Zöllen, Quoten und preis- sowie mengenabhängigen Schutzmaßnahmen vor einer Importflut zu schützen, wenn die Existenzgrundlage der heimischen Bevölkerung auf dem Spiel steht. Bei dieser Neustrukturierung der Handelsregeln könnte die Europäische Union zu einem Vorreiter werden.
Wieso soll ausgerechnet die EU für mehr Gerechtigkeit sorgen?
Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.