Der Pflichtwandel

Zumindest darin waren sich alle einig – ob es sich um weiße Firmenbesitzer, schwarze Gewerkschafter oder grau melierte Wirtschaftswissenschaftler handelt: So konnte es nicht weitergehen. Als das neue Südafrika mit den ersten allgemeinen Wahlen 1994 aus der Taufe gehoben wurde, kontrollierten schwarze Südafrikaner weniger als zwei Prozent der an der Johannesburger Börse gehandelten Werte, obwohl sie fast 90 Prozent der Bevölkerung ausmachten. Nur vier Prozent aller Manager waren dunkler Hautfarbe, unter den Vorstandsvorsitzenden betrug ihr Anteil sogar nur 0,2 Prozent. Mit einem Gini-Koeffizienten von 68 Punkten, der den Grad der Wohlstandsverteilung auf einer Skala von 0 bis 100 (größte Ungleichheit) angibt, gehörte das Kap der Guten Hoffnung zu den ungleichsten Staaten dieser Welt. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt der Gini-Koeffizient rund 28 Punkte, in Indien 37 und in den USA rund 41. Südafrika hat aufgeholt, aber mit 57,8 Punkten ist der Wohlstand noch immer höchst ungerecht verteilt.
„Wenn gegen solche Verhältnisse nichts unternommen wird“, erklärt der Johannesburger Wirtschaftswissenschaftler Azar Jammine, „kann ein Land niemals zur Ruhe kommen.“ Zunächst reagierte Südafrikas weiße Geschäftswelt Mitte der neunziger Jahre auf die Bedrohung neuer Unruhen, indem sie ausgesuchten schwarzen Entrepreneuren mit besten Verbindungen zur neuen politischen Elite Aktienanteile ihrer Unternehmen anbot. Die Finanzierung erfolgte in der Regel über Kredite, die über die ausgeschütteten Dividenden bedient werden sollten. Diese „Black Economic Empowerment“-Initiative (BEE), die auch von der Regierung unterstützt wurde, bewirkte immerhin, dass sich nach einigen Jahren mehr als sechs Prozent der Werte der Johannesburger Börse im Besitz dunkelhäutiger Südafrikaner befanden. Dann aber schwappten die Auswirkungen der asiatischen Finanzkrise von 1997/98 auch über das Kap der Guten Hoffnung. Die Zentralbank musste ihren Leitzinssatz auf mehr als 20 Prozent anheben – ein kreditfinanzierter BEE-Deal nach dem anderen kollabierte. Übrig blieb weniger als eine Handvoll schwarzer Wirtschafts-Tycoons, die genug Rücklagen hatten, um den Kollaps zu überstehen: Zur Jahrtausendwende ging der Anteil der von dunkelhäutigen Südafrikanern kontrollierten Börsenwerte erneut auf weniger als zwei Prozent zurück.
„Spätestens jetzt war jedem klar, dass es allein über die Umverteilung der Aktienwerte nicht funktionieren konnte“, zieht Azar Jammine Bilanz. Die Regierung beauftragte einen der Tycoons – den ehemaligen Gewerkschaftsführer und Präsidentschaftskandidaten des Afrikanischen Nationalkongresses, Cyril Ramaphosa –, einen Masterplan zur Transformation der Wirtschaft zu entwerfen. Ramaphosas Kommission legte wenig später, im Jahr 2000, ein ausgefeiltes Konzept vor, das nicht nur mit dem Stotter-Akronym BBBEE (für „Broad-Based Black Economic Empowerment“) auf sich aufmerksam machte, weshalb in Südafrika weiterhin von BEE gesprochen wird. Die umfassende Transformationsstrategie gehört auch international zu den bedeutendsten wirtschaftspolitischen Regelwerken der Zeitgeschichte und wurde als „echte wirtschaftliche Revolution“ gepriesen.
BRAUCHEN WIR GESETZE? ODER HOFFEN WIR AUF DEN GUTEN WILLEN?
Es ging dabei um die grundsätzliche Frage, wie Gesetze Unternehmen dazu verpflichten können, aktiv den Wandel der Gesellschaft mitzugestalten. Denn Freiwilligkeit allein, das hatte die große soziale Ungleichheit in Südafrika beispielhaft gezeigt, führt nicht immer zum Ziel. Manchmal braucht es einen gewissen Druck, damit sich Unternehmen in die richtige Richtung bewegen: Gleichstellungsgesetze, CR-Richtlinien und in Südafrika eben das BEE-Konzept. Ob die Rechnung der Gesetzgeber wie erhofft aufgeht, ist dann allerdings eine andere Frage.

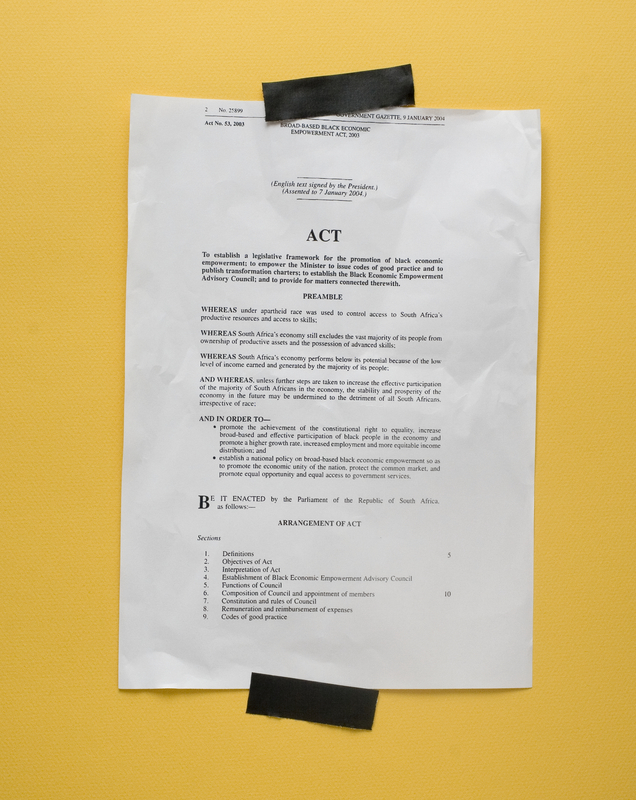
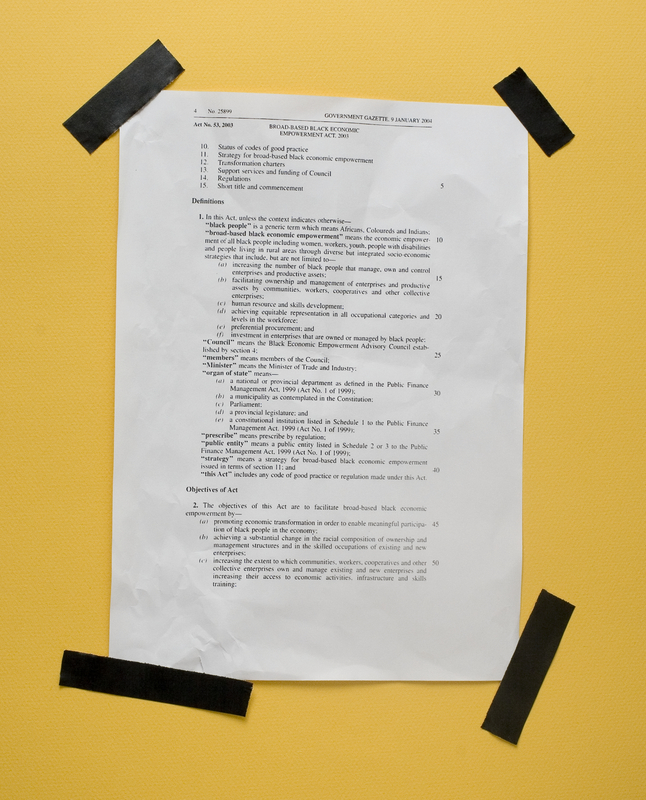
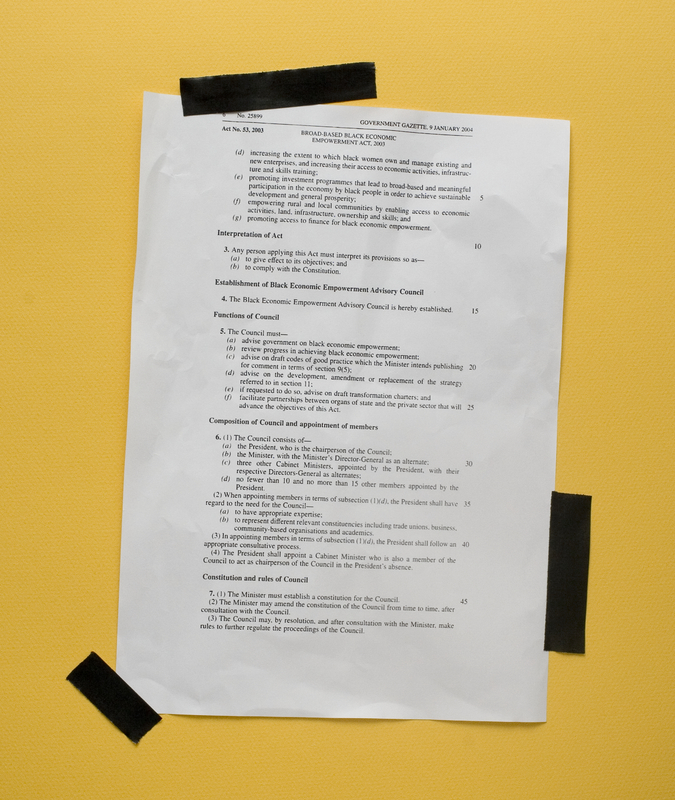
Ramaphosas Kommission identifizierte sieben Bereiche, in denen sich die Reform der Firmenwelt zu vollziehen habe. Neben der Umverteilung der Besitzverhältnisse gehört dazu die Vergrößerung des Anteils von Schwarzen, die strategische Führungspositionen in Betrieben einnehmen. Außerdem wird die (ethnische) Zusammensetzung der Belegschaft bewertet sowie die Frage, von welchen Firmen das Unternehmen seine Lieferungen bezieht. Von entscheidender Bedeutung soll ferner sein, was ein Betrieb für die Ausbildung seiner (schwarzen) Belegschaft tut und was er zum Aufbau neuer (schwarzer) Kleinunternehmer leistet. Und schließlich kommt es auch darauf an, inwieweit ein Unternehmen seiner sozialen Verantwortung generell gerecht wird: ein Bereich, der in Südafrika als „Corporate Social Investment“ (CSI) bezeichnet wird.
Die Grundsätze dieser Vorschläge wurden 2004 in einem Gesetz festgeschrieben. Wesentlich detailliertere Ausführungen wurden in den jeweiligen „Chartern“ formuliert, die inzwischen für fast jeden Industriezweig definiert worden sind. Ihr Herzstück ist die sogenannte „Scorecard“: ein Zeugnis, auf dem die Erfolge eines Unternehmens in den Transformationsdisziplinen wie Schulnoten festgehalten werden. Die sieben Fächer sind gewichtet: Die meisten Punkte (20 Prozent) kann ein Unternehmen mit der Umverteilung der Eigentumsverhältnisse erzielen, die wenigsten (5 Prozent) gibt es für CSI.
Das BEE-Zeugnis hat keineswegs nur kosmetischen Charakter: Von ihm hängt vielmehr ab, ob ein Unternehmen bei der Vergabe von staatlichen Aufträgen in Betracht gezogen werden kann – im Minensektor steht sogar der Erhalt der staatlichen Lizenz auf dem Spiel. Und weil mit
Blick auf die Zulieferer nur jene Unternehmen belohnt werden, die mit bereits bevollmächtigten Partnern Geschäfte machen, kann sich kein Marktteilnehmer dem staatlichen Druck entziehen – es sei denn, seine Firma macht weniger als umgerechnet 300000 Euro Umsatz im Jahr und ist deshalb vom Zeugniszwang befreit.
Es wäre verwunderlich, wenn ein derart detaillierter und verbindlicher Verhaltenskodex unter Verfechtern der freien Marktwirtschaft keinen lauten Aufschrei der Empörung auslösen würde. Schließlich gilt jedes Regelwerk, noch dazu ein derart umfangreiches, als eine lästige Bremse der Produktivität.
Hinter verschlossener Tür stöhnen die Unternehmer über Korruption und Druck
Umso erstaunlicher ist es, ausgerechnet Anglo-American-Chef Philip Baum das Hohelied auf die drei Bs und die zwei Es singen zu hören: „Black Empowerment ist nicht nur ein politisches, sondern ein ökonomisches Gebot“, meint der Geschäftsführer des Minenbetreibers und größten Unternehmens in Südafrika. Lange bevor der Gesetzgeber eingegriffen habe – sogar noch zu Apartheidszeiten – habe Anglo American aus eigenen Stücken massive Anstrengungen zur Integration schwarzer Südafrikaner in die Ökonomie des Landes unternommen, erzählt der Bergwerksmanager: Unter anderem sei in den achtziger Jahren ein Netz kleiner „schwarzer“ Zulieferfirmen aufgebaut worden – schon, um verbesserten Wettbewerb und angemessene Preise zu ermöglichen.
Heute gilt Anglo American in Sachen politischer Korrektheit und sozialem Engagement als weltweit mustergültig. In Deutschland landet der Konzern regelmäßig auf einem der vordersten Ränge des vom Manager Magazin initiierten „Good Company Ranking“. In Südafrika gibt Anglo Millionenbeträge für Stipendien, Sozialprojekte und die Behandlung HIV-infizierter Beschäftigter aus. Mit seinem tadellosen BEE-Zeugnis musste das Unternehmen bis heute kein einziges Mal um seine Versetzung, beziehungsweise seine Abbaulizenzen, bangen. Die Investitionen in soziales Engagement zahlen sich offenkundig aus. Philip Baum hält sie ohnehin nicht für Almosen, sondern für den Ausdruck der Erkenntnis, dass man keine „nachhaltige Ökonomie schaffen kann, wenn man die Mehrheit der Bevölkerung ausschließt“. Kollegen, die das nicht genauso sehen, fehlt in seinen Augen entweder die „Einbildungskraft“ oder der „Sinn für größere Zusammenhänge“.
In diese Kategorie fallen viele, vor allem, wenn sie die Reformvorgaben hinter verschlossenen Türen kommentieren. Im Schutz der Anonymität weisen viele Geschäftsführer auf die Schattenseiten des politischen Eingriffs hin. „Natürlich sind auch wir davon überzeugt, dass sich etwas ändern musste“, meint der Chef eines kleinen Minenhauses: „Doch so, wie das in der Praxis läuft, lässt es sich im internationalen Wettbewerb nicht lange aufrechterhalten.“ Da ist zunächst der bürokratische Aufwand, mit dem sich der Manager herumschlagen muss. Wie viele Betriebe muss er einen ganzen Stab an BEE-Experten unterhalten, die seine Firma durch die Klippen der Bestimmungen steuern, denn das Versetzungszeugnis muss Jahr für Jahr neu beantragt werden. Als das Unternehmen den Erfordernissen der Minen-Charta entsprechend 15 Prozent seiner Anteile einer Gruppe schwarzer Südafrikaner übereignen wollte, seien dafür zwei Jahre dauernde Verhandlungen, insgesamt 40 Einzelverträge und umgerechnet fast eine Million Euro Anwaltsund Bankenkosten nötig gewesen, erzählt der Mann. Ganz abgesehen von dem Wertverlust, den die Firma durch die Finanzierung des gesamten Deals erlitt.
Hinzu addieren sich aus Sicht der Kritiker die Verlockungen der Korruption, die sich in der hoch regulierten Wirtschaftsarena ergeben. Weil die Versetzungszeugnisse von den jeweils zuständigen Regierungsverwaltungen unterzeichnet werden müssen, komme es immer wieder vor, dass die Beamten bei der Auswahl von BEE-Partnern ihnen verbundene Kandidaten durchsetzten, erzählt ein ausländischer Investor. Wehe dem, der einen solchen Amtsmissbrauch an die große Glocke hänge: Der müsse sich um künftige Abbaulizenzen gar nicht erst bewerben. Die Abhängigkeit von regierungsamtlicher Bewilligung erzeuge eine Kultur der Duckmäuserei, schimpft der einstige Oppositionschef Tony Leon: „Die Unternehmer pflegen vor der Regierung regelrecht unter den Tisch zu kriechen.“
All das lässt die Stimmung gegen die Transformationsstrategie allmählich kippen. Tatsächlich behebe sie den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften nicht – zurzeit wohl das größte Problem der südafrikanischen Wirtschaft –, sie verstärke ihn noch. Weil zum BEE-Kanon eben auch die Vorschrift zählt, dass die Belegschaft eines Unternehmens die tatsächlichen Größenverhältnisse der jeweiligen Bevölkerungsgruppen widerzuspiegeln hat: Um diesem Ziel näher zu kommen, muss bei Neueinstellungen die „ehemals benachteiligte Bevölkerungsgruppe“, also Südafrikaner dunkler Hautfarbe, bevorzugt werden.
Staatsunternehmen wie der Stromkonzern Eskom, der einst überwiegend Weiße beschäftigte, werden vom dramatischen Wechsel der Belegschaft besonders mitgenommen: Die schwere Stromkrise, die Südafrikas Ökonomie im Jahr 2008 bis zu zwei Prozentpunkte Wirtschaftswachstum kosten könnte, wird zumindest zum Teil auf die massive Abwanderung erfahrener weißer Ingenieure zurückgeführt.
Kein Zweifel, „Affirmative Action“, die bevorzugte Behandlung historisch Benachteiligter, kann nur funktionieren, wenn das Bildungssystem eines Landes genügend qualifizierte Kandidaten für die Umverteilung der Arbeit produziert. Genau dies ist am Kap der Guten Hoffnung aber nicht der Fall: Nach Auffassung aller Experten steckt das Land in einer anhaltend tiefen Bildungskrise. Noch immer beenden nach Angaben des Statistikamtes in Pretoria lediglich 1,8 Prozent der schwarzen Bevölkerung ihre Ausbildung mit einem Hochschulabschluss, während es unter Weißen fast zehnmal so viele sind – 15 Prozent. Das Missverhältnis führt zu der absurden Situation, dass immer mehr Jobs von einem sehr begrenzten Pool an schwarzen Profis zu besetzen sind, während weiße Absolventen ihr Glück in anderen Teilen der Welt suchen. Oft werden die wenigen schwarzen Fachkräfte schon nach kurzer Zeit vom nächsten Unternehmen abgeworben, das ein unverhältnismäßig hohes Gehalt zu zahlen bereit ist, nur um sein BEE-Zeugnis zu verbessern. Auf diese Weise wird nach Ansicht des Wirtschaftswissenschaftlers Azar Jammine unter Südafrikas Yuppies eine „Spielcasino-Mentalität“ genährt. Dabei hätte das Land eine Kultur, die eine qualifizierte Ausbildung, die Leistung und Einsatz belohnt, wirklich dringend nötig.
Ausbildung statt Umverteilung scheint vielen ein besserer Weg zur Gleichstellung
Experten, die täglich mit BEE zu tun haben, stehen der gegenwärtigen Transformationsstrategie denn auch mit wachsender Skepsis gegenüber. Jenny Cargill, Gründerin der Beratungsfirma Businessmap, verweist etwa auf das in der Regel höchst angespannte Verhältnis zwischen den weiß dominierten Mutterunternehmen und ihren schwarzen BEE-Partnern und hält das System für „viel zu kompliziert“. Aus Sicht von Azar Jammine ist „das richtige Rezept bislang noch nicht gefunden“: Die 110 Milliarden Dollar, die der gesamte Transformationsprozess die südafrikanische Wirtschaft nach seinen Erhebungen insgesamt kostet, sollten lieber in die Ausbildung schwarzer Fachkräfte gesteckt werden – damit würde sich das Verteilungsproblem auf wesentlich produktivere Weise lösen lassen.
Die entscheidende Frage, ob der Transformationsprozess das Wirtschaftswachstum fördert oder bremst, ist nach einer Studie des Johannesburger Wirtschaftswissenschaftlers Stephen Gelb wegen mangelnder Daten hingegen noch nicht eindeutig zu beantworten: Erste Indizien sprächen allerdings dafür, dass BEE dem Wachstum eher im Wege stehe. Selbst Vuyo Jack, der Gründer der BEE-Rating-Agentur „Empowerdex“, wagt noch kein Urteil darüber, ob die gegenwärtige Version der Transformationsstrategie erfolgreicher als ihre Vorgängerin sein wird. Für den 32-jährigen Buchprüfer bleibt der Prozess kompliziert: „Die Tatsache, dass wir einen relativ schmerzfreien politischen Übergang erlebt haben, bedeutet noch lange nicht, dass auch die wirtschaftliche Transformation ganz ohne Schmerzen abgehen wird.“ Jack vergleicht den Lernprozess, den die weiße Geschäftswelt hinter sich zu bringen habe, mit den fünf Phasen, die Sterbende nach den Beobachtungen der Psychiaterin und Wissenschaftlerin Elisabeth Kübler-Ross durchlaufen: Verdrängung, Wut, Feilschen mit dem Schicksal, gefolgt von Depression, bis schließlich das Unvermeidliche akzeptiert wird.
Nach der Auffassung des ehemaligen Präsidenten der deutsch-südafrikanischen Handelskammer Klaus Döring, heute Siemens-Chef in Südafrika, ist es entscheidend, ob BEE „nur einen kostenlosen Transfer von Eigentum an nicht qualifizierte Personen“ bedeute oder ob auch „zusätzliche Wertschöpfung“ erzielt werde. So wie die ökonomische Ertüchtigung dunkelhäutiger Südafrikaner bisher praktiziert worden sei, habe sie „weder ein einziges neues Produkt noch ein einziges, von der großen weißen Muttergesellschaft unabhängiges Unternehmen hervorgebracht“, beklagt auch der Unternehmer Moeletsi Mbeki, der Bruder des Präsidenten: In seiner derzeitigen Form sei der Transformationsprozess „zur Pleite verurteilt“.
Unter Experten setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Ausbildung von Fachkräften und der Aufbau neuer, schwarz geführter Unternehmen der beste Motor für eine dynamische Umgestaltung wäre. Wirtschaftswissenschaftler Stephen Gelb plädiert deshalb für eine völlige Neugewichtung der BEE-Bewertung, in der statt der Umverteilung der Eigentumsverhältnisse die Förderung neuer Unternehmen und die Ausbildung schwarzer Fachkräfte als Hauptfächer benotet werden.
Auch BEE-Anwalt Vuyo Jack hat dies im Blick, wenn er jetzt eine dritte Phase des Transformationsprozesses fordert. „Wir brauchen keine schwarzen Gesichter in den Vorstandsetagen, die sich nur durch ihre Pigmentierung von weißen Kollegen unterscheiden“, meint der Firmengründer. „Wir brauchen neue Unternehmen, neue Jobs und eine sich ehrgeizige Ziele setzende schwarze Unternehmerschaft.“ Afrika habe vom Westen zwar das Profitdenken, nicht aber den Unternehmergeist übernommen, klagt der prominente afrikanische Politologe Ali Mazrui. Das lässt sich ändern. Allerdings nicht per staatlichem Dekret.
Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.