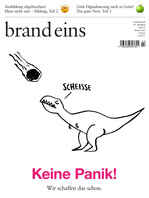Unser wahres Ich
Der Mensch ist von Natur aus selbstsüchtig und eigennützig. So heißt es.
Stimmt nicht, sagt der niederländische Historiker und Autor Rutger Bregman.
Ein Blick in die Geschichte zeige:
Wir sind viel besser, als wir denken.
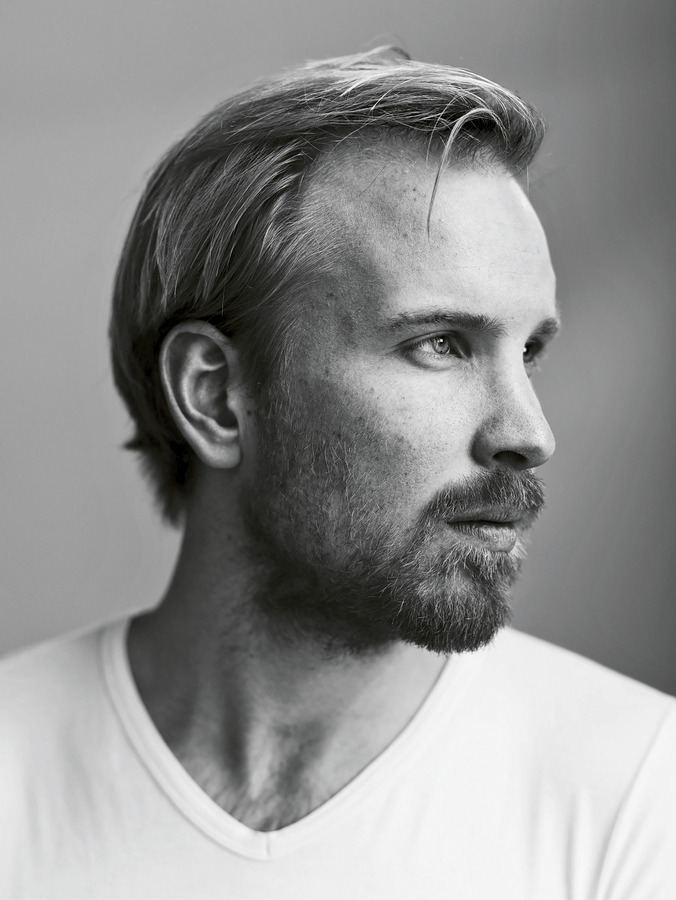
brand eins: „Im Grunde gut“ heißt Ihr Bestseller, in dem Sie die vermeintlich schlechte Natur des Menschen auseinandernehmen. Während wir darüber sprechen, führt 2000 Kilometer weiter östlich Russland Krieg gegen die Ukraine, weltweit sind Demagogen auf dem Vormarsch, und die Menschheit fummelt selbstmörderisch am Thermostaten ihres Planeten. Kann man unsere Spezies da „im Grunde gut“ nennen?
Rutger Bregman: Das ist alles deprimierend, keine Frage. Die Menschheit hat jedoch schon sehr viel verheerendere Kriege und schlimmere Krisen erlebt. Angeblich zeigen Menschen in solchen Extremsituationen ihre schlechteste Seite. Nehmen Sie den Hurrikan Katrina im Jahr 2005 im Südosten der USA: Damals hörte man schreckliche Geschichten aus New Orleans über Plünderungen, Gewaltausbrüche und Morde, sogar an Kindern.
Wir freuen uns, dass Ihnen dieser Artikel gefällt.
Er ist Teil unserer Ausgabe Keine Panik!