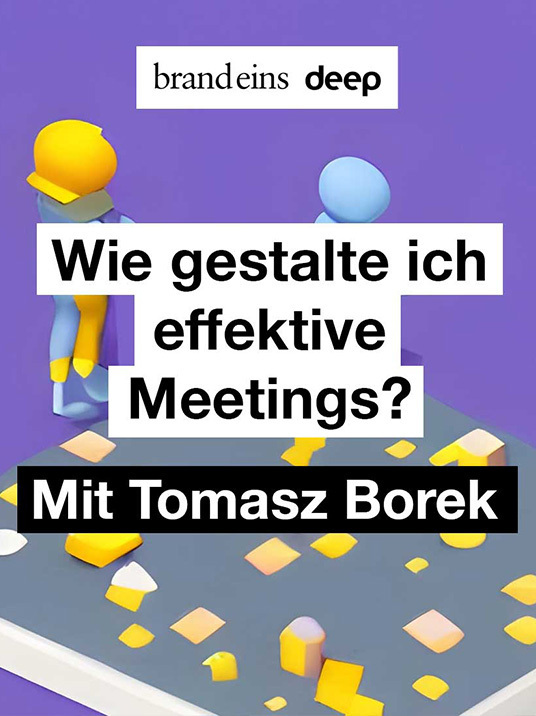Das große Blabla
Sie sind eine Landplage im modernen Büroalltag – Meetings, Konferenzen, all die Zusammenkünfte, die den Beteiligten Zeit und Nerven rauben. Was dagegen hilft? Nachdenken.
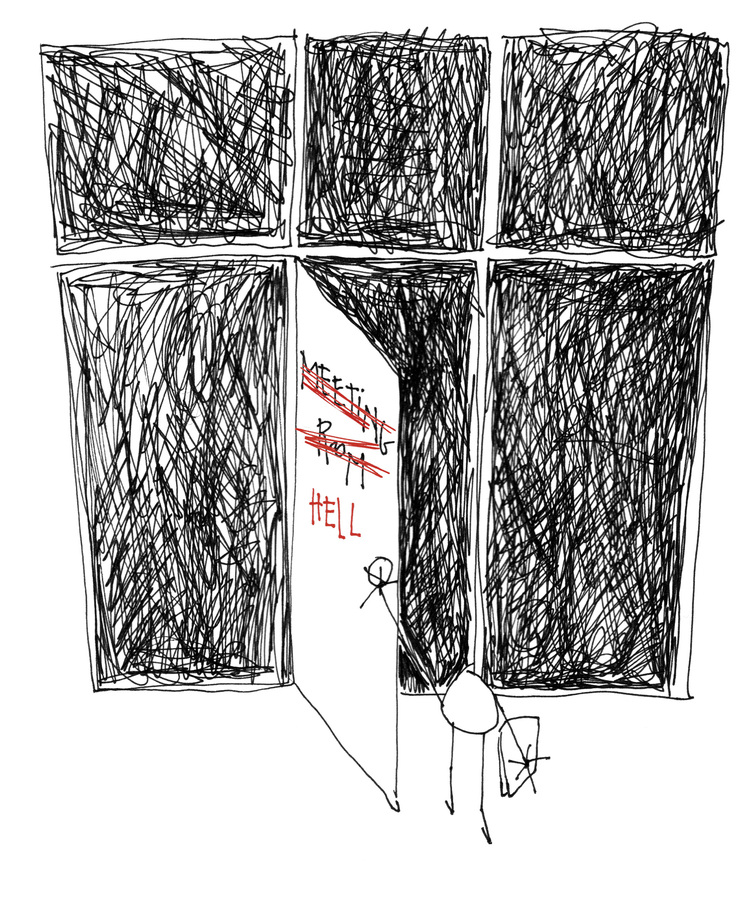
• Morgens, halb zehn in Deutschland, bei einem Dienstleister der Energiebranche. 14 Leute sitzen um ein Tischoval, es riecht nach kaltem Kaffee. Die zweite Stunde neigt sich schon, aber die Besprechung leider nicht dem Ende entgegen. Lauschangriff auf den inneren Monolog eines geplagten 41-jährigen Vize-Teamleiters; die Namen sind ausgetauscht – und austauschbar:
„Jetzt redet Meier wieder, der redet ja sehr gern. Und das in diesem badischen Singsang. Aber was erzählt der denn da? Entschuldige mal, aber hatte nicht eben Müller genau das Gleiche gesagt? Vielleicht mit ein bisschen anderen Worten, wobei: eigentlich nicht mal das, nur auf Hochdeutsch. Dabei war Top 8 endlich durch, natürlich mit unklarem Ergebnis. Keine Ahnung, was die Sabrina vom Sales da ins Protokoll geschrieben haben will, das eh keiner mehr checkt außer Müller, der Kontrollfreak. Der biegt sich die Ergebnisse nachher so zurecht, wie er sie braucht. Aber wieso muss der Schleimer Meier das gesprochene Nichts jetzt noch mal ventilieren? Hört der sich zu? ,Das zweite Audit können wir schlanker gestalten‘ – wurde doch eben schon gesagt, ,das eigentlich für Juni vorgesehene Benchmarking vorziehen‘ – bereits vorgeschlagen, und zwar von mir, ,die Transformation beim Partner ist auf gutem Weg‘. Blablabla.
Und dafür hab’ ich heute Morgen das Joggen gecancelt? Na klar, der schöne Lars, wie immer hinten links am Tisch, schüttelt wie immer seinen gut aussehenden Kopf, ausnahmsweise mal zu Recht. Kaum zu glauben, dass der erst 34 ist, bei den Mundwinkeln. Graben sich direkt zum Erdmittelpunkt vor. Und um zwölf ist schon der Termin mit dem Fuzzi vom Provider. Da hab’ ich kaum noch Zeit, die neuen Zahlen in die Vorlage einzuarbeiten. Und es stehen, warte, noch drei Punkte auf der Agenda. So viel Tagesordnung für so wenig Tag! Haben die alle nichts zu tun? Der Lehmann macht’s richtig, spielt hemmungslos auf seinem neuen Tablet rum. Schlechte Kinderstube hat auch was für sich. Oh, was diese Kekse nach ranziger Butter stinken. Und morgen ist schon das Kundenmeeting in Brüssel, puh. Frische Luft wäre mal gut …“
So oder so ähnlich läuft es oft, sehr oft, zu oft, morgens halb zehn – oder halb zwölf, um 14 oder um 16 Uhr. Geschäftsführer, die mental in den Neunzigern hängen geblieben sind, scheuen sich auch nicht, Meetings noch auf 18 Uhr zu legen. Kommunikationsforscher nennen diesen Typus Familienvermeider. So einer quält lieber seinen Familienersatz in der Firma mit einer Präsenzpflicht, statt in seiner echten Familie präsent zu sein und sich von der eigenen Brut quälen zu lassen.
Egal, ob sie Meeting heißen, Jour fixe, Sitzung, Besprechung oder Konferenz – immer wieder weist die Forschung nach, dass zu vielen Angestellten und Vorgesetzten die zu vielen Arbeitstreffen auf die Nerven gehen. Der Befund liegt seit Jahren vor, er wird aber nicht besser, sondern eher schlechter. Mitarbeiter deutscher Unternehmen und Institutionen verbringen mittlerweile rund sechs Stunden in 2,4 Meetings pro Woche – im Durchschnitt. Die Hälfte dieser Stunden, so das bedrückende Ergebnis neuer Studien, ist unproduktiv und damit überflüssig. Und zwar nicht nur gefühlt, sondern gemessen.
Da wird also kostbare Arbeitskraft und kreative Energie auf Kunstfaserstühlen oder Ledersesseln platt gesessen, über Millionen von Stunden hinweg. Schließlich verbringen Spitzenmanager sogar bis zu 90 Prozent ihrer Arbeitszeit in Meetings – bei einer 40-Stunden-Woche sind das 36 Stunden. Bei mittleren Führungskräften sind es immer noch bis zu 60 Prozent. Paradox ist nur: Dieselben Manager, die Treffen einberufen, kreuzen dann auf den einschlägigen Fragebögen der Forscher „reine Zeitverschwendung“ an.
Nun haben Arbeitspsychologen einen neuen Tiefpunkt der Meeting-Kultur vermessen: Wer zu viel in zu schlecht geführten Meetings sitzt, kann davon sogar seelisch krank werden. Das hat ein Team der Technischen Universität Braunschweig um die Professorin Simone Kauffeld herausgefunden. Die Forscher haben in durchschnittlichen Firmenbesprechungen eine erschreckende Quote ausgemacht: Von je 1000 gezählten Sinneinheiten (den Interaktionen zwischen den Teilnehmern) dienten nur zwei bis drei dem Zweck der Zusammenkunft. Simone Kauffeld nennt das verbreitete Phänomen „Entscheidungslegasthenie“. Und die zieht ein Team runter. Wer immer wieder mit der Annahme in eine Besprechung gehe, da kommt eh nichts raus, und darin dauernd bestätigt werde, „der wird erst unzufrieden und dann unglücklich“, sagt sie. Das mache mürbe und gemütskrank. Psychosomatische Symptome wie Erschöpfung und Schlafstörungen zeigen den Missstand an.
Statt Prozesse voranzubringen, halten Meetings sie also auf – oder schaden sogar. So war das aber nicht gedacht.
Als der Begriff im deutschsprachigen Raum aufkam, war er nicht einfach nur ein modischer Anglizismus für die gute alte deutsche Sitzung. Sondern er hielt mit der zunehmenden Teamarbeit Einzug. Die neue Art der Besprechung wollte eine moderne Form der Mitarbeiterführung sein und auch ihrer Beteiligung. Ein Meeting war (und ist) eigentlich dazu da, Produktions- und Entscheidungsprozesse zu demokratisieren, sie transparent für die Beteiligten zu gestalten und dabei die Erfahrungen und das Wissen der Mitarbeiter auszutauschen, abzuschöpfen und an richtiger Stelle wieder einzuspeisen, um dieselben Mitarbeiter sodann am Erfolg teilhaben zu lassen – nämlich wieder in einem Meeting.
Eigentlich eine super Idee, das Problem heute ist nur: Das Gros der Manager scheint das Instrument inflationär zu benutzen, ohne es zu beherrschen. Das fängt schon bei der Gruppengröße an. „Sieben bis acht Teilnehmer wären ideal, aber um die zwanzig sind in Deutschland die Regel“, sagt die Forscherin Kauffeld. „Oft weiß die Hälfte dann nicht, worum es geht. Und wenn sie es erfährt, merkt sie, dass es gar nicht ihren Aufgabenbereich betrifft.“ Ab dann wächst der Frust über die vertane Zeit.
Vielleicht wären viele Führungskräfte insgeheim gern so frei, wie Kevin Roberts es zu sein vorgibt, der Chef der Werbeagentur Saatchi & Saatchi. Auf die Frage, ob er Meetings abhalte, um der Kreativität auf die Sprünge zu helfen, sagte er einmal der »Welt«: „Ich mache keine. Meetings sind Zeitverschwendung. Dinge werden nie im Konsens geschaffen, sondern ausschließlich durch Schmerz und Leidenschaft.“
Man darf aber unterstellen, dass es den meisten herkömmlichen Managern an derart übermenschlicher Genialität und Leidensfähigkeit gebricht – und sie schlicht auf ihre Teams und deren Input angewiesen sind. Meetings und Telefonkonferenzen, sagt etwa der Forschungsleiter einer Biotech-Firma aus Sachsen-Anhalt, „sind für mich oft die einzige Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben“. Heißt: Wenn der Mann von seinen zahlreichen Präsentationen aus Übersee zurückkehrt, muss und will er wissen, was inzwischen in den Labors passiert ist, wie es um die Finanzierung der laufenden Versuchsreihen steht und welche Schritte als nächste geplant werden müssen. Mit ein paar Rund-E-Mails, sagt der Mann, sei das einfach nicht getan.
Der Trick: Meeting im Stehen
Bleibt die Frage, warum ein Gutteil derselben Manager, die vorgeben, zu viele Termine im Kalender zu haben, sie nicht absagen. „Weil das Meeting nach wie vor die beste Form sein kann, um seine Leute an Bord zu holen, wenn es um neue Projekte und Themen geht“, sagt Katharina Heuer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP). Gerade in Zeiten des Umbruchs, wenn Unternehmen vor großen Veränderungen stünden, hält sie das Reden von Angesicht zu Angesicht für unverzichtbar.
„Das Team aufgleisen“ hat das Heuer, 46, früher selbst genannt, als sie noch verantwortlich fürs Personal war, erst bei Daimler, später bei der Deutschen Bahn. Dass die Zahl der Besprechungen und Telefonkonferenzen überhandnimmt und die Angestelltenwelt ganz kirre macht, schreibt sie einer zunehmenden Komplexität der Aufgaben in nahezu allen Branchen zu. Darum müsse sich jeder fragen – und nicht nur der Chef: „Brauche ich wirklich ein Meeting? Oder reicht auch ein Briefing?“ Denn nur effizient abgehaltene Treffen könnten effektiv sein.
Stephan Buchhester weiß, was passiert, wenn das Gegenteil der Fall ist: nichts. Als junger promovierter Wirtschaftspsychologe stieg der heute 39-Jährige in die Personalentwicklung eines deutschen Automobilkonzerns ein. Er sollte dort ein Bildungsprogramm für 6000 Mitarbeiter entwi-ckeln. „Es ging grob gesagt darum, ob wir künftig selbst ein Angebot gestalten oder ob wir eine Art Reisebüro bleiben, das die Mitarbeiter nur zu externen Schulun-gen schickt.“ Natürlich hätten sie darüber gründlich beratschlagen müssen, „aber nicht so und nicht so lange“. Als anderthalb Jahre und unzählige fruchtlose Klausuren und Konferenzen später noch immer kein Bildungskonzept stand, seilte er sich ab. Für ihn lag ein klarer Fall von „Verantwortungsdiffusion“ vor: Am Ende war keiner zuständig für nichts. Entscheidungen blieben aus, Erfolge damit auch.
Buchhester übernahm dann die Regionalleitung einer renommierten Personalberatung. Er war für die neuen Bundesländer zuständig und konnte seinen Effizienzdrang ausleben. Sein Credo: „Alles ist messbar!“ Das gelte nicht nur für den Erfolg von Bildungsmaßnahmen, die er heute für Unternehmen evaluiert und auswählt, sondern gerade auch für Meetings.
Für seine eigenen stellte er strenge Regeln auf. Jedes Thema durfte höchstens dreimal auf Besprechungen auftauchen: wenn es vorgeschlagen und diskutiert wurde, wenn der Lösungsweg gefunden war und um zu schauen, ob die Lösung funktioniert hatte. Und er erfand das „Infusionsmeeting“: das Team heranholen, kurz auf den Stand bringen und wieder an die Arbeit lassen.
Es begeistert ihn, dass Ursula von der Leyen in ihrer Zeit als Bundesfamilienministerin die Arbeitstreffen an Stehtischen abgehalten haben soll, ganz ohne Kekse. „Stehen hält wach und fördert die Konzentration“, urteilt Buchhester.
Dagegen waren für ihn die Klausuren im Hauptquartier seines Arbeitgebers in Hannover ein Graus. „Die gingen über neun Stunden! Ich konnte auch einfach nicht mehr sitzen.“ Ausgerechnet gestandene Personalberater befolgten einfachste Konferenzregeln nicht: moderieren, Protokoll führen, den Tag am Ende auswerten. „Ich konnte mein Hingehen irgendwann nicht mehr rechtfertigen. Hätte ich es getan, hätte ich gegen meine Überzeugungen gehandelt und wäre womöglich krank geworden.“ Buchhester machte sich selbstständig, als Coach, Personalentwickler und Hochschullehrer. Zwischenzeitlich kam er sogar wieder mit dem Autokonzern ins Geschäft. „Aber da verliefen die Treffen auf meine Art – und siehe da, es funktionierte.“
Tratschen ist ausdrücklich erlaubt
Gut möglich, dass der Mann in seinen Angestelltenjahren zu den Enthusiasten zählte, vielleicht auch zu den Selbstdarstellern – das sind von Organisationspsychologen ausgemachte typische Charaktere, die in keinem Meeting fehlen. Da gibt es außerdem den Nörgler, der alles anzweifelt, aber keine Lösung sucht, außerdem den Schweiger, den Ideendieb und den Zeitfresser, der alles Gesagte wiederholt – und natürlich den Wichtigtuer. Der fällt gern anderen ins Wort oder nimmt Anrufe hemmungslos gleich am Tisch entgegen.
Die Sache ist nur: Von jedem dieser Charaktere steckt etwas in jedem Menschen. Die Kunst ist es, damit umgehen zu lernen, das jeweils andere aus ihm herauszukitzeln.
Das fängt schon mit der Einladung an. „Es sollten nur Mitarbeiter dazugeholt werden, die wirklich Ahnung vom Thema haben und für das Projekt wichtig sind“, sagt eine 42-jährige Diplomkauffrau aus Berlin. Sie arbeitet seit 13 Jahren bei einer Beratungsfirma und weiß über Meetings nichts Schlechtes zu sagen. Das ist so eine Seltenheit, dass es neugierig macht.
Ihr Arbeitgeber hat sich auf mittelständische Banken und Finanzdienstleister spezialisiert – eine Klientel, die rechnen kann. Schon deshalb sind die Berater gehalten, ihre Treffen mit den Kunden konzentriert durchzuführen. Das hat auf die interne Organisation der Firma mit ihren 900 Mitarbeitern abgefärbt. „Es muss klare Ziele geben, und die werden vorher aufgeschrieben“, sagt die Controllerin. Nicht, dass jemand aus Versehen ein Brainstorming als Meeting tarnt. „Das muss man dann auch so nennen, sonst geht es schief.“ Weitere eherne Regeln, wie aus dem Bilderbuch vorbildlicher Arbeitsorganisation: Die Agenda liegt rechtzeitig jedem vor und auch die dazugehörige Vorlage. Es wird während des Treffens Protokoll geführt, das nachvollziehbar festhält, wer bis wann welche Aufgabe zu erledigen hat. Die Erfolgskontrolle folgt zeitnah und verlässlich. Und es gibt vor allem einen Moderator, der diesen Namen verdient.
Das muss nicht unbedingt ein Chef sein. Der oder die Verantwortliche muss nur den Ablauf steuern und straffen, Einwände und Anregungen ordnen und ernst nehmen. „Ein guter Moderator muss zuhören und zulassen können“, sagt die Beraterin. Wer nur die Bestätigung seiner eigenen Meinung suche, werde nicht das Optimum herausholen. Wie all das geht, lernt jeder Neuling gleich im ersten Jahr in Workshops.
Man muss jedoch an die richtigen Trainer geraten. Die Psychologin Simone Kauffeld hat eine ihrer Studien in einer Firma gemacht, die ihr Geld bundesweit mit solchen Moderations-Workshops verdient. Was sie erlebte, verblüffte sie: „Nicht eine der Regeln der guten Moderation, die diese Trainer anderen beibringen, haben sie auf sich angewandt.“ Entsprechend groß sei der Frust im Team gewesen.
Sowieso gelte: Der Fisch stinkt vom Kopf her. Wenn die Arbeitsforscher eine schlechte Meeting-Kultur in den Produktionshallen eines Betriebes diagnostizieren, können sie hohe Wetten darauf abschließen, dass es oben, bei den Chefs in der Panorama-Etage, keinen Deut besser aussieht.
Meetings allein auf Effizienz zu trimmen propagiert die Professorin übrigens nicht, im Gegenteil. Jammern, Tratschen, der Small Talk zum Aufwärmen hat eine Berechtigung. „Wenn sich ein Team nur zum Meeting in genau dieser Zusammensetzung sieht, muss Raum geschaffen werden für den sozialen Austausch“, sagt sie. Der muss aber auch begrenzt werden.
Es gibt da hübsche Hilfsmittel: Man kann eine Viertelstunde eher als nötig einladen, aber die dann vor dem Konferenzraum im Stehen bei einer Tasse Kaffee verplaudern. Oder man stellt einen Flipchart als „Klagemauer“ auf – jeder Teilnehmer kann da mit einem Stichwort anschreiben, was ihn im Arbeitsalltag nervt. Dasselbe funktioniert auch als „Jammerbox“, ein Zettelkasten für den Frust der vergangenen Wochen. Im Anschluss nimmt sich die Moderatorin eine halbe Stunde Zeit, mit den Teilnehmern die Kritik durchzugehen. „Aber danach werden gnadenlos die Frontscheinwerfer angestellt, und es geht nur noch um das aktuelle Projekt“, sagt Kauffeld.
Die sogenannte dysfunktionale Kommunikation kann man also wunderbar steuern und eindämmen, theoretisch. Wenn da nur die Praxis nicht wäre. Seit einiger Zeit ist Simone Kauffeld im Präsidium ihrer Universität und sitzt in diversen Kommissionen. Sie erlebt oft, dass all die hilfreichen Analysen und Methoden für eine gute Gesprächsführung, die sie erfolgreich in die Wirtschaft hinausträgt und an ihrem eigenen Lehrstuhl vorlebt, nicht immer erwünscht sind. Die Zeitfresser und Vielredner haben den Tanker fest im Griff. Sie sagt: „Für viele ist so ein Meeting auch ein Wohlfühlfaktor und nur dann gut, wenn es lange dauert.“ Um konzentriert arbeiten und denken zu können, hat Kauffeld darum stille Stunden für sich geblockt, am späten Nachmittag und abends, wenn die Kinder im Bett sind. In ihrer Freizeit. --
brand eins deep:
Wie gestalte ich effektive Meetings?
Tomasz Borek, Experte für Lean-Teamwork, kennt Lösungen. In der 60-minütigen brand eins deep-Session mit ihm, lernen Sie, wie Sie mithilfe von Design Sprint Methoden, in Meetings schneller zu echten Ergebnissen und Entscheidungen kommen – und dabei alle Beteiligten sinnvoll einbeziehen.