Zukünfte, die (Plural)
In unserer zunehmend komplexen Welt gibt es die Zukunft nur noch in der Mehrzahl. Und Zukünfte lassen sich nicht planen. Aber sie lassen sich denken. Berater, Forscherinnen und Kulturexperten erzählen, wie das gehen kann.
/ Disruption! Eine große Veränderung. Die wird uns weiterbringen. Darauf hatten sich vor nicht einmal zehn Jahren Vordenker und innovative Manager geeinigt. Auf in ein goldenes Zeitalter! Ihr Wunsch wurde wahr. Wirtschaft und Gesellschaft wurden von einem Tsunami an Disruption überflutet: Corona, Klimakrise, Krieg in Europa, Lieferkettenprobleme, KI, Fachkräftemangel … Es waren so viele Erschütterungen, dass mittlerweile für viele das Ideal eine absehbare Welt wäre. Aber das wird nichts mehr. Und das wissen auch alle.
Und nun? Schwer zu sagen. Was die Menschen morgen können müssen, ist noch in der Entwicklung, doch die UNESCO hat mit dem Begriff Futures Literacy zumindest einen Anfang gemacht. Er benennt die Fähigkeit, sich die Auswirkungen des eigenen Handelns auf diverse Zukünfte vorstellen zu können. Das ist essenziell, denn: Zukünfte kommen nicht – sie werden geschaffen.
Die folgenden Gedanken von Gesprächspartnern, die sich schon länger mit der Entwicklung von Zukünften beschäftigen, sind jedoch keine Gebrauchsanweisungen, sondern Inspiration. Im Umgang mit Zukünften gibt es kein Richtig und Falsch mehr – es gibt nur noch Versuch und Irrtum.

Justine Walter hat in Sinologie und Alte Geschichte promoviert, war als Zukunftsforscherin tätig und arbeitet jetzt als Managing Director der Digital Impact Labs in Leipzig.
Veränderung trainieren
„Während ich in Taiwan meine Magisterarbeit geschrieben habe, gab es viele Erdbeben, und die Leute vor Ort haben darauf eher gelassen reagiert. Das brachte mich darauf, den Umgang mit Naturkatastrophen in antiken Gesellschaften in China und im Mittelmeerraum zu erforschen. Schon damals wurden Change-Management-Strategien genutzt.
Im antiken Griechenland gab es Prävention per baulicher Veränderung, außerdem wurden Tempel für den Gott Poseidon gebaut – der war für Erdbeben zuständig. In China glaubte man, dass Erdbeben vom Himmel kommen, also musste der Kaiser mit dem Himmel kommunizieren, um sie zu verhindern. Gab es trotzdem eines, hat er sich beim Volk entschuldigt.
In Bezug auf Innovation und Zukunft haben uns diese Kulturen viel voraus – die Menschen wussten damals, dass jederzeit etwas Unvorhersehbares passieren kann. Wir dagegen glauben, uns gegen alles absichern zu können, weil wir mittlerweile gute Instrumente für Vorhersagen haben. Aber auch die sind von der aktuellen Dynamik überfordert. Gleichzeitig wächst in den Unternehmen der Wunsch, in sicheres Fahrwasser zu kommen. Doch wie soll das gehen?
Ich glaube, mit Veränderungen umzugehen ist Übungssache. Das ist wie bei Erdbeben: Wenn du kleine Erdbeben gewohnt bist, kommst du mit großen besser klar. Es geht darum, den Umgang mit Veränderung zu trainieren.
Oft arbeiten wir dafür klassisch mit Szenarien: Wir schauen uns bestimmte Entwicklungen an und denken sie weiter, um uns abzusichern oder auch zukünftige Chancen zu nutzen. Unser zweiter Ansatz ist das Zukünftelabor, das auf Futures Literacy aufbaut. Da überlegen wir, wie sich der Markt eines Unternehmens entwickeln wird. In der Regel haben davon alle eine klare Vorstellung, aber meist nicht die gleiche – das ist schon mal interessant.
Darauf aufbauend fragen wir: Wie hättet ihr die Zukunft gern? Was wünscht ihr euch? Die Antworten klingen meist ganz anders. Und dann fragen wir: Wie kommt es, dass sich das, was ihr für wahrscheinlich haltet, von dem, was ihr euch wünscht, dermaßen unterscheidet? Da tritt viel zutage, was den konstruktiven Umgang mit Veränderungen blockiert. Implizite Annahmen über die Zukunft zum Beispiel, die wir alle haben, aber nie thematisieren. Und am Ende steht die Frage: Was können wir tun, um in die Zukunft zu kommen, die wir uns wünschen?
Die Arbeit mit Szenarien reduziert Komplexität – das tun Unternehmen gern, weil es alles einfacher macht. Das Zukünftelabor beachtet Komplexität. Ich zeige in meinen Workshops oft einen Kegel, der nach oben, zur weiter entfernten Zukunft, größer wird, und sage: ,Da sind viele Zukünfte drin – was passiert, hängt von uns ab.‘ Wir können auf wünschenswerte Zukünfte hinarbeiten, aber wir können sie nicht eins zu eins erwirken. Das ist kein linearer Prozess.
Um dafür nachhaltig ein Bewusstsein zu implementieren, führen wir in einigen Unternehmen jedes Jahr Workshops zu diesem Thema durch. So etwas geht aber auch intern, als Arbeitskreis im Unternehmen mit Leuten aus allen Bereichen, der sich mit neuen Trends und Technologien beschäftigt. Das hat zudem den Vorteil, dass es immer Leute gibt, die sich mit Themen, die plötzlich aktuell werden, schon beschäftigt haben.
Manchmal arbeiten wir auch mit Wildcards, verrückten Zukünften. Zum Beispiel: ,Stell dir vor, um klimafreundlich zu werden, erlässt die Regierung ein neues Gesetz, nach dem jeder nur noch zehn Stunden die Woche arbeiten darf.‘ Solche Szenarien lassen sich auch koppeln, dann heißt die Aufgabe beispielsweise: ,Du darfst nur zehn Stunden pro Woche arbeiten, und zugleich wird der Stromverbrauch pro Jahr auf 2000 Kilowattstunden gedeckelt – du kannst nicht mal Netflix sehen.‘
Da wird es richtig interessant.“
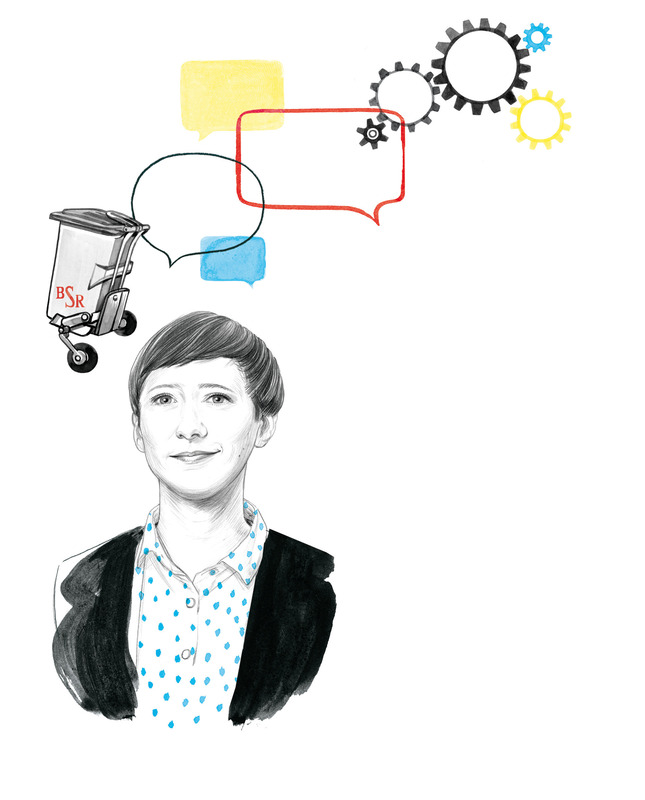
Die Kommunikationswissenschaftlerin Lena Maria Heidingsfelder arbeitet seit zehn Jahren im Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI). Sie unterstützt wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen dabei, gesellschaftlich akzeptierte Produkte, Technologien, Dienstleistungen, Modelle und Strategien zu entwickeln.
Debatten sichtbar machen
Frau Heidingsfelder, womit genau beschäftigt sich das CeRRI?
Lena Maria Heidingsfelder: Unsere Grundfragen lauten: Wie lassen sich Forschung und Entwicklung verantwortlich gestalten? Wie kann die Gesellschaft in die Gestaltung von Forschung und Innovationen einbezogen werden?
Das klingt recht abstrakt. Haben Sie vielleicht ein handfestes Beispiel?
Wir haben für die Berliner Stadtreinigung (BSR) gearbeitet, die wissen wollte, wie sie sich für 2030 und darüber hinaus aufstellen kann. Dafür haben wir Stadtentwicklungsszenarien entworfen und überlegt, was sie für die BSR bedeuten würden. Wir haben gesellschaftliche Trends berücksichtigt, aber auch technologische wie Sensorik zur Mülltrennung – Entwicklungen, die sich heute in der Laborphase befinden, aber irgendwann kommen werden. Und dann haben wir in einer Veranstaltung mit 176 Berliner Bürgerinnen und Mitarbeitenden darüber diskutiert. Außerdem gab es einen Online-Dialog, um eine höhere Reichweite zu erzielen.
Wie sah die Veranstaltung aus?
Wir haben in einer großen Halle einen Mix aus Ausstellung und Beteiligung inszeniert. Wir haben Szenarien gezeigt, zum Beispiel: Wofür könnte die BSR Drohnen nutzen? Und haben gefragt: Wie wäre es für euch als Mitarbeiterinnen oder Bürger, wenn das gemacht würde? Es ging um Akzeptanzbedingungen und Impulse aus Stadtgesellschaft und Belegschaft. Dieses Vorgehen nutzen wir oft, wenn es um soziotechnische Entwicklungen geht. Wir entwickeln Szenarien und versuchen, sie haptisch erlebbar zu machen, üblicherweise mit Prototypen.
Die werden tatsächlich gebaut?
Ja, das sind richtige Objekte. Die wenigsten Menschen verstehen ein Szenario über Texte, sie müssen etwas sehen und anfassen. Unser Ansatz heißt Design Fiction: Dabei geht es nicht darum, Prototypen zu bauen, die es in Zukunft wirklich gibt – die Modelle sollen Debatten sichtbar machen und Diskussionen anstoßen. Deshalb sind sie manchmal auch etwas zugespitzt.
Sie sprachen von verantwortlichem Handeln – war das bei der BSR auch ein Thema?
Klar, wenn beispielsweise Sensorik genutzt wird, gibt es immer Angst vor Überwachung, aber auch vor rechtlichen Schwierigkeiten: Darf ich das überhaupt? Und dann sind da soziale Fragen.
In einer Diskussion ging es um das automatische Aufsammeln von Müll, für das es schon technische Lösungen gibt. Doch es wurde diskutiert, ob es nicht sinnvoller wäre, die Leute dazu zu bringen, mit ihrem Müll selbstverantwortlich umzugehen. Die Frage war: Wenn die BSR einen Full Service anbietet, verlernen die Leute dann einen vernünftigen Umgang mit Müll? Wir haben sogar darüber diskutiert, ob die BSR Pakete austragen könnte, weil sie ohnehin viele Strecken abfahren muss.
Und was ist dabei rausgekommen?
So ein partizipativer Dialog gibt den Perspektiven unterschiedlicher Gruppen Raum und schafft damit eine breite Grundlage für eine informierte Entscheidung. Das ist sinnvoll bei sehr komplexen Problemen. Aber wenn es um unternehmerische Entscheidungen geht, liegen die natürlich immer noch bei der Führung.
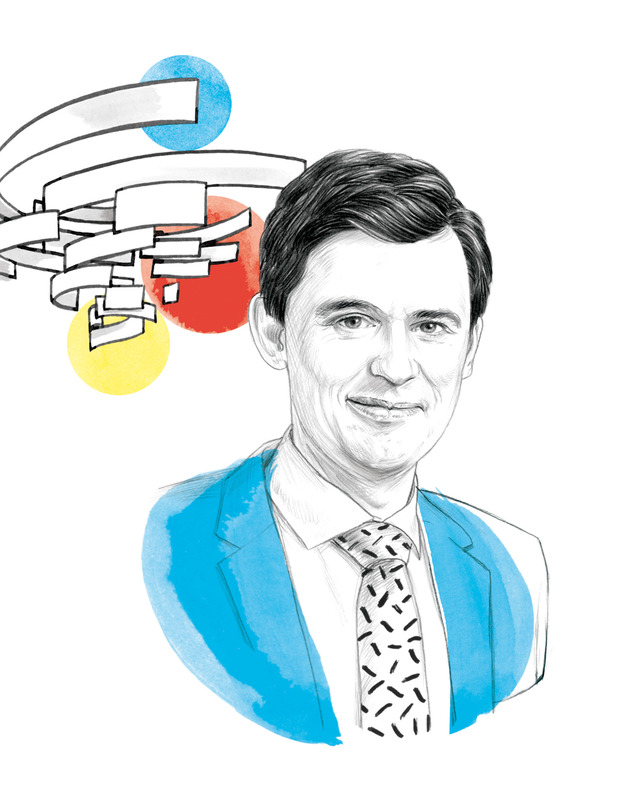
Stefan Brandt war Musiker, Musikwissenschaftler, Berater für McKinsey und Geschäftsführer der Hamburger Kunsthalle, bevor er 2017 Direktor des Berliner Futuriums wurde. Das „Haus der Zukünfte“ in Berlin mit Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen über Zukunftsthemen wird getragen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie von Forschungsorganisationen und Unternehmen.
Offen bleiben
„Das Haus verkörpert Offenheit. Das beginnt damit, dass wir keinen Eintritt nehmen. Es ist ein Angebot an alle, sich zu informieren, zu interagieren oder auch Spiele zu spielen, die sich mit Zukunft beschäftigen. Am Ende verlassen uns die Gäste hoffentlich mit dem Gefühl, dass die Zukunft ein Raum ist, der sich gestalten lässt. Vielleicht können sie sogar etwas dazu beisteuern – letztlich kann jeder Mensch auf die eine oder andere Weise Zukunft beeinflussen. Ein gutes Beispiel ist Greta Thunberg, die völlig unbekannt war, bevor sie mit ihrem Schulstreik Millionen Menschen weltweit inspiriert hat. Das passiert, wenn man sich etwas zutraut.
Wir haben gelernt: Je abstrakter ein Thema ist und je schwieriger, desto weniger Interaktion und desto weniger Engagement gibt es. Also sind wir im Futurium möglichst konkret. Wir zeigen auch Dystopien, aber das ist nicht unser Fokus – die Menschen hören ständig und überall negative Szenarien. Wir sind nicht naiv, wir sagen nicht: Alles wird gut. Aber letztlich ist es doch so: Wenn wir nicht auf Zufälle oder höhere Mächte hoffen wollen, können nur wir selbst die Zukunft positiv gestalten. Und dafür braucht es einen Ort der Zuversicht.
Natürlich findet trotzdem sehr viel kritische Auseinandersetzung statt. Kritik ist ein wichtiges K der sogenannten 21st Century Skills: Kollaboration – wir schaffen es nur gemeinsam. Kommunikation – wir müssen uns verständigen. Kreativität – wir brauchen Fantasie und Ideen. Kritik – wir sollten Zukunftsplanungen und Zukunftsversprechen hinterfragen.
Deshalb verändern wir unsere Dauerausstellung auch ständig. Den Teil über die Zukünfte der Demokratie gab es bei der Eröffnung 2019 zum Beispiel noch nicht. Als die gesellschaftlichen Spannungen noch nicht so stark wie heute, aber schon spürbar waren, haben wir begonnen, diesen Teil aufzubauen.
Dabei machen wir uns immer sehr viele Gedanken darüber, was ein Thema publikumswirksam macht. Für uns sind das unter anderem diese Punkte: Es muss echte Bedürfnisse ansprechen, es sollte Möglichkeitsräume eröffnen und in der Umsetzung lebensnah sein. Wir sehen uns an, woran gerade geforscht wird, welche Debatten sich abzeichnen und wie sich Bedürfnisse ändern. Wir tauschen uns mit vielen Expertinnen und Experten aus. Und dann versuchen wir alles zusammenzubringen – so ist die Chance auf einen Treffer wesentlich größer, als würden wir uns nur Details herauspicken.
Einen Einblick in die Zukunftsthemen, die unser Publikum bewegt, bietet unser Wünschespeicher. Er steht gleich am Eingang. Jeder Gast kann dort seine Wünsche für die Zukunft abgeben. Inzwischen haben wir über 400 000 gesammelt, von privaten Wünschen wie ,Ich will, dass meine Mama wieder gesund wird‘ bis zu ,Ich möchte eine nachhaltige Welt‘. Das ist übrigens ein Wunsch, der sehr häufig genannt wird, ebenso wie ‚menschenwürdige Arbeit‘, die sinnstiftend ist und angemessen bezahlt wird.
Der Mensch ist eben beides: Kollektiv- und Individualwesen. Aber insgesamt kann man sagen, dass deutlich mehr Wünsche für die Gemeinschaft als rein persönliche Wünsche eingegeben werden. Das große Ganze bewegt die Menschen also sehr. Ich finde, das macht Mut.“

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung ist ein Biotechnologe aus Kamerun, der als Kurator seit rund zwei Jahrzehnten diverse Kulturinstitutionen, Ausstellungen und Projekte geleitet hat. Anfang 2023 übernahm er als Intendant das Haus der Kul- turen der Welt in Berlin, eine der großen Kulturinstitutionen des Bundes.
Pluralität verstehen
Wie sehen Sie die Zukünfte Ihres Hauses?
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung: Wir bringen das Plurale im weitesten Sinne zusammen: interdisziplinär, geografisch, geschichtlich, erkenntnistheoretisch. Wir zeigen unterschiedliche Welten – für die es natürlich unterschiedliche Zukünfte gibt. Eine Vielfalt von Zukünften.
In den westlichen Industrieländern haben wir naturgemäß einen westlichen Blick – sollten und könnten wir den ändern?
Der westliche Blick per se ist nicht das Problem, sondern erst, wenn die ganze Welt diesen Blick haben soll. Wir erleben gerade viele unterschiedliche Krisen, und wir sind bei einer Art des Denkens gelandet, das sich in den vergangenen 500 Jahren extrem verbreitet hat. Um das zu ändern, brauchen wir vor allem Demut. Wir müssen erkennen, dass das westliche Wissen nicht das Alpha und Omega ist, sondern dass es auch andere Wissensformen gibt.
Was meinen Sie mit Wissensformen?
Wenn wir etwa über die Klimakrise reden, müssen wir sehen, dass auch indigene Menschen Lösungen haben. Wir haben zum Beispiel in der Ausstellung „O Quilombismo“ eine Arbeit einer indigenen Künstlerin aus Neuseeland, Nikau Hindin, die mit Baumrinden arbeitet. In Aotearoa, wie die Maori Neuseeland nennen, werden damit seit Jahrtausenden Stoffe und Papier gemacht – und dafür wird nie ein Baum gefällt. Die Rinde wird stattdessen abgezogen und der Baum mit Bananenblättern umhüllt, sodass eine neue Haut wächst. Es gibt Bäume, die seit 500 Jahren Papier liefern. Das ist eine inhärent nachhaltige Lebensphilosophie.
Aber das ist doch keine Lösung für alles und alle.
Das habe ich auch nicht behauptet. Aber die Wälder abholzen ist auch nicht die Lösung. Wir müssen vom Universalismus, singulärem Wissen, zum Pluriversalismus kommen. Es gibt viel Wissen, und wir können uns das beste aussuchen, um die Welt so zu gestalten, wie wir sie für das Gemeinwohl der Menschheit wollen. Es geht nicht anders: Man kann zum Beispiel in Deutschland gut mit Zement bauen – aber in Kamerun ist das schwierig. Die Luftfeuchtigkeit liegt in Douala bei 93 Prozent, die Durchschnittstemperatur bei 35 Grad. Also sollte mit Lehm gebaut werden, weil damit ein Haus atmen kann. Zement erlaubt das nicht, da schimmelt nach kurzer Zeit alles. Eine solche Architekturkrise führt zur Gesundheitskrise. Man muss von dort aus arbeiten, wo man steht. Die Welt im Blick behalten, aber wissen, dass man für lokale Probleme lokale Lösungen braucht.
Wie wichtig ist dafür Kunst?
Kunst ist so wichtig wie Naturwissenschaften. Sie kann uns ablenken nach einem harten Tag und zeigt uns Schönheit, aber sie ist auch ein Träger von Wissen. Künstler bezeugen ihre Zeit. Nehmen Sie die Geschichte der „Zong“, einem britischen Sklavenschiff, von dem 132 Sklaven ins Meer geworfen wurden, weil die Versicherung für sie mehr einbrachte als ihr Verkauf. Das war 1781. Und ein Bild, das der Maler William Turner davon gemalt hat und das uns immer noch berührt, ist ein Grund, warum wir noch heute davon wissen.
Kunst verbindet uns über Gefühle – brauchen wir eine Lehre der Gefühle?
Ja, und dazu gehört zu erkennen, dass wir nicht allein existieren. Amadou Hampâté Bâ, ein Philosoph aus Mali, hat geschrieben, dass du eine Reflexion deiner Gesellschaft bist, dass ein Individuum in Bezügen zu unterschiedlichen Menschen besteht. Und dass wir deshalb Empathie füreinander haben können, für uns selbst und unsere Nächsten.
Das ist eine christliche Art zu denken: Ich erkenne mich in meinen Nächsten, und mein Nächster erkennt mich in sich. Es ist kulturell weit weg vom Christentum – und zugleich sehr nah. Das ist der Anfang von einer Lehre der Gefühle. Aber wir müssen das mit dem ganzen Körper denken. Deswegen spielt hier im Haus auch die Performativität eine sehr wichtige Rolle.
Welche Rolle spielen die Wissenschaften?
Eine große! Wissenschaften aus aller Welt sind wichtig. Auch das westliche Wissen. Nehmen wir Niels Bohr und die Quantenphysik. Die Quantenphysik sagt, dass ein Partikel ein Partikel sein kann und zugleich eine Welle. Wenn wir mit Quantencomputern arbeiten, denken wir nicht mehr nur binär, in unserem 010101-System.
Es ist nichts mehr schwarz oder weiß – es ist Westen, und es ist nicht Westen. Es ist ein Spektrum. Wer mit indigenen Völker spricht, stellt fest, dass an vielen Orten so gedacht wird. Deshalb müssen wir miteinander reden – um voneinander zu lernen und um Zukünfte zu bauen.
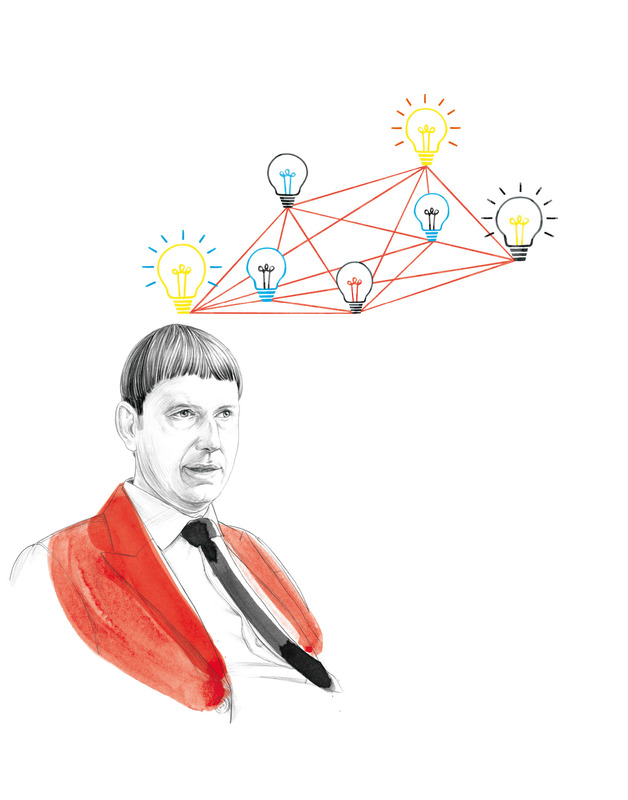
Der Physiker und Soziologe Dirk Helbing ist Professor für Computational Social Science an der ETH Zürich.
Crowdsourcen statt Planen
Planung setzt eine Welt voraus, die sich über längere Zeit kaum verändert, aber das ist immer seltener der Fall. Stattdessen brauchen wir Systeme, die entwicklungsfähig sind. Dafür müssen wir die Selbstorganisationsfähigkeit komplexer Systeme verbessern und zugleich die lokale Autonomie stärken – etwa lokal Energie erzeugen und Lebensmittel produzieren, mit 3-D-Druckern arbeiten und so weiter. Wenn wir das mit Open Data, Open Access, Open Source und Open Innovation verbinden, wird jeder Fortschritt, der irgendwo gemacht wird, ganz schnell ein Fortschritt für alle.
Wichtig ist, dass dabei die besten Ideen umgesetzt werden. Wir haben keinen Mangel an Lösungen, sondern an praktischer Realisierung. Darum ging es in dem Projekt, das wir für die Stadt Aarau durchgeführt haben. Die Frage war: Wie lässt sich kollektive Intelligenz in die Praxis bringen? In Aarau können Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden, für welche Projekte Budgets freigegeben werden. Zuerst werden Vorschläge gesammelt, und danach wird gemeinsam diskutiert, um die Ideen zu finden, bei denen die meisten Menschen mitmachen würden. Daraus entsteht eine Shortlist. Und dann wird gewählt.
Wahlzettel können ganz unterschiedlich gestaltet sein. Oft dürfen die Leute nur mit Ja oder Nein stimmen – und ausgezählt wird dann nach dem Mehrheitsprinzip. Es ist klar, was dann passiert: Bezirke mit vielen Einwohnern, meist die zentralen Bezirke, bekommen ihre Projekte durch und das meiste Geld – alle anderen gehen mehr oder weniger leer aus. Das führt zu französischen Verhältnissen: In den Zentren gibt es Vorzeigeprojekte und in den Banlieues soziale Probleme. Aber es geht auch anders!
Es hat sich bewährt, den Leuten eine bestimmte Menge Punkte zu geben, die sie verteilen können, dem Lieblings-Projekt viele Punkte und anderen guten Projekten ebenso ein paar Punkte. Diesen Punkten lässt sich aber auch ein Teil des Budgets zuordnen: Jedes Projekt hat in der Regel unterschiedliche Kosten, und wenn man die erreichten Stimmen im Vergleich zu den Projektkosten zählt, macht das einen großen Unterschied.
Insgesamt läuft unser Verfahren darauf hinaus, dass das Verhältnis von Stimmen zu Kosten entscheidet. Teure Projekte brauchen mehr Stimmen als billige. Das sorgt dafür, dass das Geld gleichmäßiger über die Bezirke verteilt wird und die Projekte sehr viel diverser sind.
Die Art, wie wir heutzutage meistens wählen, ist eine der schlechtesten überhaupt. Mit der Mehrheitswahl bestimmen wir quasi einen Diktator, der vier Jahre lang tun und lassen kann, was er will. Das ist eine Demokratur, eine Diktatur einer oft knappen Mehrheit über alle. Wir glauben, dass das so sein muss, weil uns große Herausforderungen dazu zwingen, schnell und entschieden zu handeln. Wir wollen optimale Entscheidungen. Doch Optimierung vereinfacht. Sie setzt ein eindimensionales Ziel voraus. Aus den verschiedenen Interessen vieler Individuen ermitteln wir ein Durchschnittsinteresse. Doch das ist Blödsinn, denn letztlich ist das niemandes Interesse – und keiner wird damit glücklich. Besser sind diverse Projekte.
Unser Wahlverfahren der proportionalen Fairness dient dazu, Multidimensionalität zuzulassen und von der Diversität zu profitieren. Es müssen für eine Entscheidung nicht alle dasselbe wollen, es braucht keinen allgemeinen Konsens – Konsens ist an sich eine totalitäre Idee. Unser Ansatz dagegen erlaubt Pluralität, bei der viele Menschen nebeneinander existieren und sich gegenseitig befruchten können. Davon profitiert auch das Gemeinwesen – also die Stadt im Ganzen und ihre Funktionalität. //