Betriebliche Gesundheitsförderung
In Beweisnot
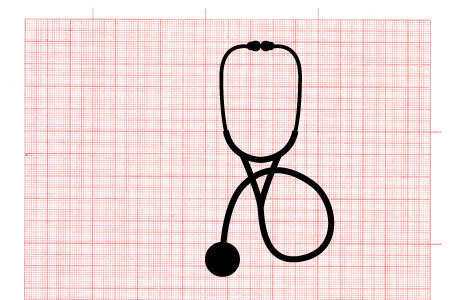
Mittags in der Werkskantine. „Was ist denn das für eine Suppe?“, fragt eine Mitarbeiterin aus der Verwaltung die Frau an der Essenausgabe. „Das ist die Suppe aus der Brigitte-Diät“, lautet die Antwort. Skeptisch blickt die Kantinenbesucherin auf die vielen Fettäuglein, die auf der Suppe schwimmen. „Die sieht aber sehr gehaltvoll aus.“ – „Ja“, sagt die Frau mit der Suppenkelle strahlend. „Die hat erst überhaupt nicht geschmeckt. Aber dann hab’ ich ein paar Becher Sahne reingekippt, und jetzt ist sie richtig lecker.“
Rolf Müller-Eicken lacht herzhaft über die kleine Episode aus den Niederungen der Gesundheitsförderung seiner Fabrik, die niemand besser kennt als er, der langjährige Werksleiter. Wer viel richtig macht, kann über so einen kleinen Fauxpas hinwegsehen. Manchmal gibt es eben noch Verbesserungspotenzial im Feintuning des Gesundheitsmanagements – auch im Werk des Autoglasherstellers Saint-Gobain Sekurit in Herzogenrath, nördlich von Aachen.
Die Ausgangssituation im Jahr 2005 war weitaus ernster. Damals nahm Rolf Müller-Eicken die Zusammensetzung seiner Belegschaft genauer unter die Lupe. Beim Blick auf die Altersstruktur der etwa 1000 Beschäftigten in Herzogenrath zeigte sich, dass der Altersdurchschnitt der Belegschaft in einigen Jahren erstmals über 40 liegen würde.
Der Werksleiter sah ein Problem dräuen. Er kannte die einschlägigen Statistiken der Krankenkassen, die allesamt belegten, dass mit zunehmendem Alter die Fehlzeiten vor allem durch chronische Krankheiten ansteigen und die Leistungsfähigkeit nachlässt. Damals ging das Gespenst der Produktionsverlagerung ins Ausland um, auch unter den deutschen Automobil-Zulieferern. Die Chinesen stellten mittlerweile ebenfalls ganz passable Autoscheiben her. Und die letzten Nischen der Gemütlichkeit in den Produktionsstätten waren längst ausgekehrt. Müller-Eicken legte Tabellen und Diagramme beiseite und traf eine Entscheidung. „Wir müssen zusätzlich etwas tun, um unsere Mitarbeiter gesund und leistungsfähig zu halten.“ Und um ihre Arbeitsplätze zu sichern.
Mit dem Aachener Arbeitsmediziner Michael Suchodoll, der das Werk schon seit Jahren als Betriebsarzt betreute, arbeitete Müller-Eicken ein ambitioniertes Gesundheitsprogramm aus, das über die Region Aachen hinaus bis heute als vorbildlich gilt. Alle Mitarbeiter können sich aus einem Vorsorge-Paket bedienen – es reicht von Blutdruck- und Cholesterinmessung über Belastungs-EKG mit Laktatwert-Analyse, Lungenfunktionstest, Augeninnendruckmessung und großem Blutbild mit Leber- und Nierenwerten bis zu Haut-, Venen- und Urin-Screening.
„Unser Programm enthält viele Untersuchungen, die von den Kassen nicht bezahlt werden, wenn der Mitarbeiter privat zum Arzt geht – es sei denn, er hat schon Krankheitssymptome“, sagt Müller-Eicken. Die Kosten für alle Teilnehmer am Vorsorgeprogramm übernimmt das Unternehmen.
Der Wahrnehmungswandel
Mit seinem Entschluss, in die Gesundheit seiner Belegschaft zu investieren, steht Rolf Müller-Eicken stellvertretend für einen Wahrnehmungswandel in den Führungsetagen deutscher Firmen und Behörden. „Viel stärker als noch vor zehn Jahren erkennen Personalverantwortliche die Gesundheitsförderung als wichtiges Thema“, berichtet Wolfgang Panter, Präsident des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte. Der wachsende Anteil älterer Beschäftigter bedürfe nun einmal größerer Hinwendung, damit sie gesund und in Beschäftigung blieben. „Das Bewusstsein, dass man an dieser Stelle gezielt etwas tun muss, hat sich allgemein durchgesetzt.“
Erst vor Kurzem signalisierten die Resultate des Gesundheitsreports der Betriebskrankenkassen (BKK) akuten Handlungsbedarf. Der durchschnittliche Krankenstand der BKK-Versicherten war 2013 im siebten Jahr in Folge gestiegen – auf nunmehr 17,6 Tage pro Jahr. Wobei sich die Fehlzeiten mit zunehmendem Alter häufen: Mit Ende 50 sind Beschäftigte im Schnitt rund doppelt so viele Tage im Jahr krank wie ihre 30-jährigen Kollegen. Wenn ältere Leistungsträger oder Spezialisten lange Zeit ausfallen und nicht zu ersetzen sind, bekommen Arbeitgeber die schmerzhaften Folgen des demografischen Wandels deutlich zu spüren.
Der nachdrückliche Aufruf
Doch die betriebliche Gesundheitsförderung ist keine Veranstaltung für Mitarbeiter, die bereits ihre Rente im Visier haben. Auch Beschäftigte zwischen 30 und 40 Jahren, die sich also in der „Rushhour des Lebens“ zwischen Karriere, Familie und Hausbau permanent am Limit befinden, sollten so früh wie möglich gegensteuern, wenn gesundheitlich etwas aus dem Ruder läuft. Wer in jungen Jahren die ersten Warnsignale des eigenen Körpers ignoriert, läuft Gefahr, sich mit Anfang 50 bei den chronisch Kranken wiederzufinden.
Werksleiter Müller-Eicken erklärte in Herzogenrath die Gesundheit der Belegschaft zur Chefsache. Als Inkubator und Motor in einer Person trieb er die Umsetzung des Programms entschlossen und robust voran. „So etwas muss top-down betrieben werden“, davon ist er noch heute überzeugt. „Nur wenn der Promoter ganz oben in der Hierarchie steht, hat man einen Garanten dafür, dass ein solches Programm auch gelebt und mit den nötigen personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet wird.“
Selten in seiner langjährigen Praxis hat Betriebsarzt Suchodoll einen Werkschef erlebt, der den Präventionsgedanken derart konsequent bis in den letzten Winkel der Fabrik diffundieren ließ wie Müller-Eicken. „Er beließ es eben nicht bei Appellen“, sagt der Mediziner. Zur monatlichen Präsentation der Führungskräfte gehörte beispielsweise immer auch ein Bericht der Teilnahmequote an den Vorsorgeuntersuchungen. „Und wenn das mal nur 20 oder 25 Prozent waren, fragte er nach den Gründen, forderte eine bessere Quote – und vergaß das Thema beim nächsten Mal ganz sicher nicht.“
Die ersten Erfolge
Nach einer Bestandsaufnahme der bis dahin dokumentierten Krankheiten und Beschwerden entwarf der Betriebsarzt ein maßgeschneidertes Programm für unterschiedliche Tätigkeits- und Belastungsprofile. Denn Rückenschmerz ist nicht gleich Rückenschmerz: Den Arbeiter in der Produktion zwickt’s im Kreuz, weil er oft schwere Lasten heben muss. Der Abteilungsleiter im Büro hat ähnliche Beschwerden – aber aus anderem Grund: Er kauert den ganzen Tag mit rundem Rücken und hängenden Schultern vor seinem Rechner. Und deshalb unterscheiden sich eben auch Behandlungen und Vorsorgepläne.
Der Rhythmus der Untersuchungen wurde in die Abläufe der Fabrik eingepasst. „Der Manager kommt einmal im Jahr in die Praxis des Betriebsarztes und erhält an einem Vormittag das gesamte Paket inklusive Auswertungsgespräch“, erklärt Müller-Eicken. Anders beim Schichtarbeiter. Damit die Produktion möglichst wenig gestört wird, findet sein Gesundheits-Check in der Fabrik statt, und zwar häppchenweise. Für jede Teiluntersuchung wird er eine Viertelstunde aus der Schicht herausgeholt, danach geht er sofort wieder zurück an seinen Arbeitsplatz.
Schon die hohe Teilnahmequote am Vorsorgeprogramm war ein großer Erfolg – sie lag bei rund 50 Prozent. Geholfen hat dabei sicherlich auch, dass zwischen Mitarbeiter und Betriebsarzt dasselbe Vertraulichkeitsverhältnis besteht wie zu jedem anderen Mediziner: Die individuellen Untersuchungsergebnisse werden nicht weitergegeben, auch nicht innerhalb des Unternehmens.
Bei fast einem Drittel der untersuchten Mitarbeiter diagnostizierte Michael Suchodoll einen zu hohen Blutdruck, auch einige Fälle von Diabetes konnte er herausfiltern. Ein Mitarbeiter klagte über immer stärker werdende Rückenschmerzen. Der Betriebsarzt konnte keinen der klassischen Wirbelsäulenschäden feststellen, gab aber keine Ruhe und schickte den Mann zum Spezialisten – der mittels einer Blutuntersuchung eine Krebswucherung feststellte, die rechtzeitig operiert werden konnte.
Auch dass er einige Beschäftigte mit hohem Augeninnendruck herausfischen konnte, freut Suchodoll: „Ein halbes Jahr später wäre der Sehnerv womöglich irreparabel geschädigt gewesen. Die Leute wären erblindet oder könnten heute nur noch stark eingeschränkt sehen.“
Ähnliche Erfolgsmeldungen dringen aus anderen Unternehmen, die vergleichbare Vorsorgepakete anbieten. Bei Boehringer Ingelheim etwa, einem der größten forschenden Pharmahersteller des Landes, konnten dank einer mehrstufigen Gesundheitsüberprüfung für alle Mitarbeiter ab 40 etliche ernsthafte Erkrankungen in einem frühen Stadium erkannt und erfolgreich behandelt werden.
Angesichts solcher Resultate verwundert es, dass vielen Unternehmen in Sachen Gesundheitsprävention nach wie vor eine erhebliche Diskrepanz zwischen Wort und Tat attestiert werden muss. Eine Studie von Roland Berger Strategy Consultants ergab, dass zwar 80 Prozent der Unternehmen ein betriebliches Gesundheitsmanagement für notwendig halten, aber nur 36 Prozent entsprechende Maßnahmen umsetzen.
Und während sämtliche Dax-30-Unternehmen sowie rund drei Viertel der 500 größten deutschen Konzerne Gesundheitsprogramme bereits vorweisen können oder zumindest die notwendigen Schritte in nächster Zeit planen, existiert in weiten Teilen des Mittelstands nach wie vor „kein betriebliches Gesundheitsmanagement, das den Namen verdient“ – so das ernüchternde Urteil von Rudolf Kast, Inhaber der Mittelstands-Beratungsfirma „Die Personalmanufaktur“. Im Unternehmensalltag gibt es scheinbar genug Gründe, Gesundheitsthemen zu ignorieren.
Der Wirkungsnachweis
Einige davon listet eine Untersuchung auf, die im Auftrag der Initiative Gesundheit und Arbeit (IGA) in mittelständischen Betrieben des produzierenden Gewerbes mit 50 bis 499 Mitarbeitern durchgeführt wurde. Danach benannten die „Gesundheits-Verweigerer“ den „Vorrang des Tagesgeschäftes“ (88 Prozent), „fehlende Ressourcen“ (76 Prozent), die „fehlende Motivation der Belegschaft“ (52 Prozent) und „zu hohe Kosten“ (48 Prozent) als wesentliche Hemmnisse. Rund die Hälfte der Unternehmen in Deutschland ist sogar ohne jegliche betriebsärztliche Betreuung, obwohl die gesetzlich vorgeschrieben ist. „Wenn überhaupt etwas passiert“, weiß Arbeitsmediziner Michael Suchodoll, „dann sind es isolierte, gut gemeinte Wohlfühlaktionen.“ Hier ein Gesundheitstag, an dem die Krankenkassen um Kunden werben, dort eine Nordic-Walking-Gruppe oder ein Obsttag in der Kantine.
In Suchodolls Portfolio von immerhin rund 300 Unternehmen, die er mit einem Team aus sieben Ärztinnen und einer Psychologin betriebsärztlich betreut, betreiben „maximal zehn Prozent eine halbwegs systematische Gesundheitsförderung“. Und nur zwei oder drei schnüren ihre Einzelmaßnahmen zu einem Programm zusammen, das als Bestandteil von Führung, Zielsystem und Controlling mit externen Partnern professionell vorangetrieben wird – vom Topmanagement bis zum Mitarbeiter in Fabrikhalle, Büro und Labor.
„Die meisten denken beim Start eines Programms viel zu wenig darüber nach, wie sie mit den Ergebnissen umgehen sollen“, berichtet der Mediziner. Ein Beispiel: Der Betriebsarzt stellt fest, dass auffallend viele Mitarbeiter, die oft schwere Lasten heben müssen, unter Rückenbeschwerden leiden. „Da müsste es doch der nächste Schritt sein, die Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass die Leute diese Gewichte nicht mehr heben müssen“, findet Suchodoll. „Aber genau diesen Schritt scheuen die meisten Unternehmen, weil die entsprechenden Maßnahmen Geld kosten. Stattdessen heißt es dann: Du hast einen kaputten Rücken, geh mal zur Rückenschule.“
Die Gesundheitsförderung in Unternehmen befindet sich in ständiger Beweisnot. Immer wieder müssen sich Vorreiter wie Rolf Müller-Eicken oder Michael Suchodoll den gleichen Fragen stellen: Sinkt der Krankenstand tatsächlich? Steigern Sportprogramme wirklich die Fitness meiner Mitarbeiter? Trägt ein Raucherentwöhnungsprogramm dazu bei, dass mehr Beschäftigte vom Glimmstengel lassen? Wie effektiv sind betriebliche Programme zur Gewichtskontrolle? Die Messlatte liegt hoch, konstatiert die IGA: „Investitionen in die Gesundheit der Belegschaft lassen sich nur dann dauerhaft auf der Leitungsebene rechtfertigen, wenn sie positive Konsequenzen für das Betriebsergebnis haben.“
Im Einzelfall gelingt zumindest ein Wirkungsnachweis. Zum Beispiel beim Homöopathika-Hersteller Heel aus Baden-Baden. Das Unternehmen offerierte seinen Mitarbeitern vor einigen Jahren ein acht- und ein zwölfwöchiges Personal-Fitness-Coaching-Programm mit individuellen Trainingsplänen, Ausdauer- und Kraftübungen sowie Ernährungsvorgaben. Fast die Hälfte der Belegschaft nahm daran teil. Das Resultat: Gewichtsabnahmen zwischen drei und elf Kilo, der Bauchumfang der Teilnehmer schrumpfte um zwei bis sechs Zentimeter. Und auch der Blutdruck sank bei vielen signifikant.
Die fehlende Datenbasis
In der Mehrzahl der Fälle können die Arbeitsmediziner allerdings nur schwer nachweisen, dass sich durch ihre Intervention die Gesundheit und damit langfristig auch die betriebswirtschaftlichen Parameter tatsächlich verbessern. Zwar mangelt es nicht an Berechnungen über die sogenannte Gesundheitsrendite von Vorsorgemaßnahmen, wonach sich jeder in betriebliche Prävention investierte Euro für die Volkswirtschaft mit mindestens fünf Euro auszahlt – im Idealfall sogar mit 16 Euro.
Die Finanzchefs in Unternehmen sind damit aber kaum zu beeindrucken. Die volkswirtschaftliche Rendite interessiert sie wenig – sie wollen wissen, ob ein ganz konkretes Gesundheitsprogramm in ihrem Unternehmen seine Kosten auf absehbare Zeit wieder einspielt. Bestes Beispiel: der Krankenstand.
Suchodoll ist die Diskussion inzwischen nur allzu vertraut: „Wenn ich einem Geschäftsführer verspreche, dass wir 100.000 Euro in Gesundheitsprävention stecken und den Krankenstand dadurch auf ein Prozent reduzieren, unterschreibt er auf der Stelle. Aber diesen Beweis bleiben wir schuldig. Der Krankenstand sinkt durch Gesundheitsförderungsprogramme nicht kurzfristig. Wer die Krankheitsquote reduzieren will, sagt am besten, dass er zehn Prozent der Mitarbeiter entlassen muss.“
Ob sich der Gesundheitszustand der Herzogenrather Saint-Gobain-Beschäftigten durch das Präventionsprogramm wirklich verbessert hat?
Selbst da bleibt der Betriebsarzt vorsichtig. „Wer die Frage wissenschaftlich seriös beantworten möchte, müsste eigentlich eine Doppelblind-Studie machen, in zwei Betrieben mit gleicher Beschäftigtenstruktur, gleichem Durchschnittsalter und vergleichbaren Tätigkeiten. Der eine Betrieb führt zehn Jahre lange konsequent ein Gesundheitsprogramm durch, der andere macht nichts.“
Ein faszinierendes Gedankenspiel – das Suchodoll bei der Überzeugungsarbeit von Geschäftsführern allerdings nicht wirklich weiterhilft.
Ohne eine solide Datenbasis bleibt die Frage nach der Effektivität und der Effizienz betrieblicher Gesundheitsförderung unbeantwortbar. Dabei steigert insbesondere eine Evaluation der einzelnen Präventionsbausteine die Zielgenauigkeit des Gesundheitsmanagements. Das macht nur kaum jemand. Eine Befragung der BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH, die Unternehmen bei der Planung und Durchführung von Gesundheitsprogrammen unterstützt, ergab, dass lediglich ein Drittel der Firmen die Wirksamkeit ihrer Gesundheitsangebote systematisch überprüft.
Bei Apogepha, Spezialist für urologische Arzneimittel aus Dresden, begibt man sich jetzt an eine Auswertung des bisherigen Gesundheitsprogramms. „Wir wollen wissen, ob wir beispielsweise mit Laufen und Wirbelsäulentraining tatsächlich die richtigen Angebote im Portfolio haben“, sagt Steffi Liebig, Leiterin des Bereichs Gesundheitspolitik. Das Unternehmen setzt dabei auf Kooperation mit den Krankenkassen, die mit den aus Arztbesuchen und Klinikaufenthalten gewonnenen und anonymisierten Daten ein komplettes Abbild des Gesundheitszustands der Versicherten erstellen können.
Doch was nützt die beste Analyse der Krankheiten und Beschwerden, wenn die Präventionsprogramme die eigentlichen Problemgruppen nicht erreichen? „Gerade bei Angeboten zur freiwilligen Nutzung wie Betriebssport oder gesundem Essen in der Kantine werden häufig nur die Gruppen bedient, die sich ohnehin um ihre Gesundheit kümmern“, diagnostiziert die Unternehmensberatung Roland Berger.
Die Erkenntnis deckt sich mit der betriebsärztlichen Erfahrung. „Die Mitarbeiter, die sowieso regelmäßig Sport treiben, wollen auch wissen, ob sie 300 Watt auf dem Ergometer schaffen“, sagt Michael Suchodoll. „Aber diejenigen, die wir eigentlich haben wollen, kommen nicht. Wer viel Alkohol trinkt, will seine Leberwerte ebenso wenig wissen wie der Kettenraucher sein Lungenvolumen. Und die mit dem hohen Gewicht wollen auch nicht schon wieder hören, dass sie zu dick sind.“
Der lange Atem
Als kürzlich an einer Bundeswehrdienststelle eine Dienstsport- und Ernährungskampagne evaluiert wurde, lautete das ernüchternde Fazit: „Zu befürchten ist, dass mit der klassischen betrieblichen Gesundheitsförderung keine allgemeine und nachhaltige Verbesserung des Bewegungs- und Ernährungsverhaltens von Beschäftigten gelingen wird.“
Kein Wunder, dass sich angesichts derartiger Prognosen so manches Unternehmen im Schulterschluss mit Betriebsärzten bemüht, der betrieblichen Gesundheitsvorsorge das Image der Spaßfreiheit zu nehmen und die Motivation der Belegschaft mit einer Prise Abenteuer zu wecken. Ein Ansatz, der vielleicht nicht punktgenau medizinisch wirkt, dafür aber von Klassikern wegführt, die höchstens pflichtgemäß absolviert werden. Medice beispielsweise, ein mittelständischer Arzneimittelhersteller aus dem westfälischen Iserlohn, setzt bei seinem Programm konsequent auf Events wie Drachenbootrennen und Kraxeleien im Klettergarten, die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und en passant die Fitness verbessern. Leckere gesunde Gerichte können die Mitarbeiter in einer Show-Küche selbst zubereiten; bei den Firmen-Sportfesten, erzählt Personalentwicklungsreferentin Eva Feigi, ist stets die gesamte Eigentümerfamilie dabei – und zwar nicht im Anzug, sondern im Sportdress. Ähnlich bei Heel: Wenn der jährliche Firmenlauf ansteht – in der Region mittlerweile ein richtiger Event – wetteifern die Abteilungen darum, wer die meisten Teilnehmer auf die Strecke bringt.
Bei Saint-Gobain Sekurit dagegen ist nach acht Jahren straffen Gesundheitsmanagements der anfängliche Elan etwas verpufft: Die Teilnahmequoten sinken. „Wir beobachten heute, dass unser seinerzeit eingeführtes System bröckelt“, gibt Rolf Müller-Eicken zu, der mittlerweile Planung und industrielle Entwicklung als Direktor verantwortet. Der neue Werksleiter setzt die Prioritäten eher bei der Prävention psychischer Erkrankungen. Der Betriebsarzt ist gerade dabei, das Programm zu modifizieren, damit der Gesundheits-Check künftig auch für jüngere Mitarbeiter attraktiv ist, von denen sich viele bislang vor den Untersuchungen gedrückt haben.
Der Sinn des Ganzen
Rolf Müller-Eicken wird sich bald wieder zum jährlichen Manager-Check in Michael Suchodolls Praxis einfinden. Es ist sein achtes Mal, er würde die Untersuchung nie verpassen. Vor zwei Jahren entdeckte der Arzt beim Vergleich seiner Untersuchungsergebnisse nämlich etwas Beunruhigendes. Zwei Werte waren zum fünften Mal in Folge minimal angestiegen. Alles unterhalb sämtlicher Grenzwerte, doch der stetige Anstieg gefiel Suchodoll überhaupt nicht.
Er schickte Müller-Eicken zu einem Spezialisten, der eine seltene Krebserkrankung diagnostizierte, die sich zum Glück im Anfangsstadium befand und rechtzeitig operiert werden konnte. „Nur weil der Arzt die Vergleichswerte aus den Vorjahren hatte, konnte ihm der Anstieg überhaupt auffallen“, sagt Rolf Müller-Eicken. Er muss von der betrieblichen Gesundheitsförderung jedenfalls nicht mehr überzeugt werden. „Ohne unser Präventionsprogramm wäre die Erkrankung vermutlich zu spät erkannt worden.“
Zur Bedeutung psychischer Erkrankungen am Arbeitsplatz siehe auch: „Arbeit kann helfen“.Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.